ASTRONOMIE FÜR ANFÄNGER
ASTRONOMIE MIT FERNGLAS UND TELESKOP
Hartmut Schönherr
Sternkarten, Bücher, Apps, 230 kommentierte Links (eigene Seite)
Aufsuchkarten für das Fernglas (eigene Seite)
Beobachtungstagebuch (eigene Seite)
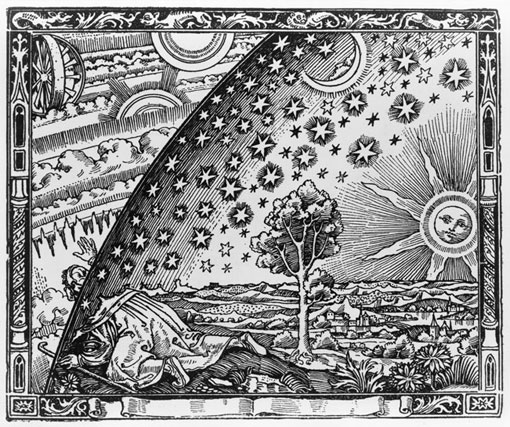
Abb. aus Camille Flammarion, L'atmosphère, 1888
Das Angebot eignet sich in weiten Teilen auch als Einführung in die Fernglas-Astronomie und möchte das Fernglas als wichtigstes Hilfsmittel zum Einstieg in die Astronomie vorstellen und als Werkzeug einer Astronomie für Alle, auch mit kleinem finanziellen oder zeitlichen Budget.
Ich danke den Communities von cloudynights.com, astronomie.de und astrotreff.de für hilfreiche Klärungen.
INHALT
1 Voraussetzungen der
Amateur-Astronomie
1.1 Zeit und Geld1.2 Frustrationstoleranz
1.3 Sehen lernen
1.4 Bastelfreude
1.5 Suchen und Finden
2 Grundentscheidungen
beim Teleskop-Kauf
2.1 Parallaktisch versus azimutal2.2 Brennweite versus Öffnung
2.3 Refraktor versus Reflektor
2.4 Manuell versus GoTo
2.5 Optisch versus digital
3 Ausrüstung
3.1 FernglasExkurs: Vergleich einzelner Modelle von Ferngläsern
3.2 Stativ und Montierung fürs Fernglas
Exkurs: Fernglasaufhängung
3.3 Sonstiges Fernglaszubehör
3.4 Spektiv
3.5 Teleskop
Exkurs: Typen und Modelle von Teleskopen/Sets
3.6 Teleskopmontierung
Exkurs: GTiX Montierung von Skywatcher
3.7 Sucher
Exkurs: TS-Optics 8x50 Winkel-Sucher
3.8 Steuerungs- und Auffindhilfen
Exkurs: Celestron WLAN-Modul
3.9 Okulare, Linsen, Filter
4 Himmelsobjekte
4.1 Sonne4.2 Mond
4.3 Planeten
4.4 Einzelsterne
4.5 Doppel- und Mehrfachsterne
4.6 Offene Sternhaufen
4.7 Kugelsternhaufen
4.8 Planetarische Nebel
4.9 Nicht-planetarische Nebel
4.10 Galaxien
4.11 Schnelle Objekte
4.12 Sternbilder
5 Probleme und Lösungen
5.1 (Fast) nichts zu sehen5.2 Unscharf, wackelig, schnell weg
5.3 Und nochmal: Wackelpudding
5.4 Auf dem Kopf stehend
5.5 Bei Nacht sind alle Katzen grau
5.6 Ich seh etwas, das du nicht siehst
5.7 Der richtige Zeitpunkt
5.8 Die Himmelsrichtung
5.9 Womit soll ich beginnen?
5.10 Justierung
5.11 Kollimation Fernglas
5.12 Alignment
5.13 Steifer Nacken, kalte Füße
6 Orientierungshilfen
6.1 Orientierung an Sternhaufen6.2 Orientierung an Einzelsternen
6.3 Orientierung an Sternbildern
6.4 Orientierung an Asterismen
6.5 Orientierung an geometrischen Strukturen
7 Aufsuchwege,
Aufsuchhilfen, Aufsuchtipps - Starhopping
7.1 Wie finde ich interessante Sternhaufen?7.2 Vom Seemöwennebel zum Kaliforniennebel
7.3 Vom Seelennebel zum Hantelnebel
7.4 Galaxien zum Einstieg
7.5 Galaxien zum Grübeln
7.6 Himmelswanderungen mit dem Fernglas
8 Vermischtes
8.1 Tagbeobachtung8.2 Aufzeichnungen
8.3 Eigenbau
8.4 Quadratur des Kreises
8.5 Isaac Newton
8.6 Sternwarten des Vatikans
8.7 Einsatz gegen Lichtverschmutzung
8.8 Therapeutikum Sternenhimmel
8.9 Astronomie und Körperbild
8.10 Konjunktionen und Oppositionen
8.11 Astrologie
8.12 Das Evangelium am Himmel
8.13 Manichäismus
9 Typologie der Sternen-Leidenschaft
10 Glossar
und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt:
Der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir."
Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft, 1788
1 Voraussetzungen
der Amateur-Astronomie
Ich habe meine Leidenschaft für die Himmelsbetrachtung im
zweiten Corona-Jahr 2021 wieder neu entdeckt. Ausflüge
machen oder gar Reisen, Ausstellungen besuchen, ins Theater
oder in die Oper gehen - all dies war derart erschwert, dass
ich dieser ganz anderen Verlockung gerne erlag, gelegentlich
das Fenster im Kopf weit aufzustoßen. Obgleich ich wohl
wusste, dass der Umgang mit dem Teleskop nicht einfach mal
so zu machen ist wie ein Kurzurlaub im Karwendel-Gebirge
oder ein Opernbesuch.Das "Teleskopieren" kostet viel Zeit, fordert Übung sowie intensive Auseinandersetzung mit der Ausrüstung - und es verlangt ein gerüttelt Maß an Frustrationstoleranz. Bedauerlicherweise ist das Wort "Teleskopieren" belegt von der Technik, Gerätschaften im industriellen Gebrauch "auszufahren" - ähnlich wie die im 19. Jahrhundert verbreiteten Fernrohr-Teleskope. Mit dem Wortsinn ("telou", gr. für "fern", "scopein", gr. für "schauen") hat diese technische Verwendung so wenig zu tun wie bei den so genannten "Teleskop"-Stöcken für das Wandern.
Für Immanuel Kant gilt im "Beschluß" seiner "Kritik der praktischen Vernunft": "Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmenden [so!] Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: Der bestirnte Himmel über mir, und das moralische Gesetz in mir." Und was er dann zum "Ding" des "bestirnten Himmels" sagt, darf sich jeder Astronom, jede Astronomin, ob Amateuer oder Profi, ins Stammbuch schreiben: "Das erste fängt von dem Platze an, den ich in der äußern Sinnenwelt einnehme, und erweitert die Verknüpfung, darin ich stehe, ins unabsehlich Große mit Welten über Welten und Systemen von Systemen, überdem noch in grenzenlose Zeiten ihrer periodischen Bewegung, deren Anfang und Fortdauer."
Die ersten Astronomen waren Mathematiker, Theologen und Philosophen. Etwas davon sollte man schon in sich tragen, ehe man sich in dieses Abenteuer stürzt und viel Geld für die Ausrüstung ausgibt. Und gewarnt sei der oder die Interessierte auch durch die Anekdote über den griechischen Naturphilosophen Thales von Milet (624-547 v.Chr.), der beim Betrachten der Sterne in einen Brunnen stürzte und darob von seiner Magd ausgelacht wurde mit dem Vorwurf, er betrachte zwar die Dinge am Himmel, aber die Dinge auf der Erde beachte er nicht.
1.1 Zeit und Geld
Ein erfahrener Himmelsgucker meinte einmal zu mir, es
brauche drei Dinge für die Himmelsbeobachtung, 1. Geduld,
2. Geduld und 3. Geduld. Und in der Tat, Geduld ist vor
allem erforderlich, um am Himmel etwas zu sehen, was nicht
auch mit dem bloßen Auge oder einem guten Fernglas schnell
zu sehen ist. Die Eigenschaft Geduld hilft allerdings
wenig, wenn nicht vor allem eines da ist: Zeit! Dieses
Hobby, dieser "Zeitvertreib" kostet Zeit, sehr viel Zeit.
Das beginnt mit der Informationssuche vor der Entscheidung
für die passende Ausrüstung, geht nach den ersten
Anschaffungen weiter mit dem Warten auf eine Nacht mit
günstigen Bedingungen (klarer Himmel, nicht zu kalt, nicht
zu später Sonnenuntergang, nicht zu heller Mond ...),
dehnt sich mit dem Herumgefummele bis die Ausrüstung
funktioniert und man mit ihr umgehen kann und endet noch
lange nicht mit den Fahrten zu geeigneten
Beobachtungsplätzen. Denn dann beginnt die Suche nach den
Objekten, die sich nicht einfach von selber in den Fokus
bringen. Nicht verkannt werden darf auch, dass es ein
Hobby mit erheblichem Suchtpotential ist. Das wirkt sich
nicht nur auf den Zeitbedarf, sondern auch auf den
Finanzmitteleinsatz aus.
Die erste Ausrüstung zeigt erfahrungsgemäß bald Defizite.
Dann wird zugekauft. Und irgendwann wird die größere,
bessere Ausrüstung angeschafft, mit größerer Brennweite um
die Planeten genauer zu sehen und/oder größerem Objektiv
mit besseren Lichtwerten für die fernen Galaxien. Und wenn
sie nicht gleich mitgekauft wurden, kommt bald das
Verlangen nach GoTo, Autoalign, Autofokus und anderem
mehr. Dabei machen viele Hobby-Astronomen den Fehler,
Enttäuschungen beim Aufsuchen und Betrachten vorschnell
auf mangelhafte Ausrüstung zurückzuführen. Sie kaufen
teure Okulare und Hilfen zum Auffinden von Himmelsobjekten
- um dann zu erfahren, dass sich nicht so viel ändert wie
erwartet. Und dann kaufen sie noch was Teureres, Besseres.
Um wieder enttäuscht zu werden. Ein gefährlicher
Mechanismus, der auch von Süchten bekannt ist. Und
irgendwann gibt es wieder eine Anzeige "Teleskopausrüstung
zu verkaufen". Oder es kommt die Einsicht, mehr Geduld
haben zu müssen, mehr üben zu müssen, den Standort
wechseln oder die Nächte besser wählen zu müssen.
Das kostet dann wieder Zeit. Doch "im Angesicht der
Ewigkeit" geht manchmal das Zeitgefühl verloren. Und die
Weite des Kosmos kann auch eine wohltuende Entlastung sein
von Widrigkeiten im Nahbereich. Was ist schon eine
Pandemie von einigen Jahren angesichts einer Galaxie, die
2.5 Millionen Lichtjahre von uns entfernt ist und doch mit
dem bloßen Auge sichtbar (Andromeda/M 31)! Lichtjahre,
schon dieser Maßstab! Räumlich können wir uns das gar
nicht vorstellen. Ein Lichtjahr, das sind
9.460.730.472.580,8 Kilometer. Eine solche Strecke legt
das Licht in einem Jahr zurück. 874.487x schneller als der
Schall ist das Licht. Das entzieht sich unserer
Vorstellung. Mit der Angabe, das Licht benötige für die
Strecke zur nächsten Galaxie, der Andromeda-Galaxie, 2.5
Millionen Jahre, können wir schon eher eine Vorstellung
verbinden als mit dem Kilometer-Produkt aus 2.5 Millionen
und 9.5 Billionen, auch wenn die zeitgebundene Vorstellung
trügerisch sein mag. Vom Stern Betelgeuse wird vermutet,
dass er demnächst in einer Supernova untergehen könnte.
Aber er ist 725 Lichtjahre von uns entfernt. Sollte er uns
also tatsächlich "demnächst" als Supernova erscheinen,
dann ist das vor 725 Jahren geschehen.
Und was sind schon 5.000 Euro für ein Teleskop, für das
ich eine Galaxie sehen kann, die 50 Millionen Lichtjahre
entfernt ist! Oder 10.000 Euro für eine Milliarde
Lichtjahre. Gefährliche Gedanken, also Vorsicht sowohl
beim Umgang mit der eigenen Lebenszeit (und der von
Partnern und Kindern), die eben nicht in Lichtjahren
bemessen ist, und beim Umgang mit den eigenen finanziellen
Ressourcen im Rahmen dieser äußerst faszinierenden und
zweifellos auch enorm bereichernden
Freizeit-Beschäftigung!
Abschließend ein Trost: Eine anfangstaugliche Ausstattung
- ohne GoTo - gibt es schon unter 350 Euro (Stand Januar
2022), z.B. das Omegon N 150/750. Dieses parallaktisch
montierte Teleskop (ein Newton-Reflektor, daher "N")
frisst erstmal keine Zeit für das Einrichten des GoTo und
die Steuerung, die erfolgt schlicht manuell, und es bringt
keine Belastung durch Stromversorgung, Ärger mit der
Motorensteuerung und andere unverhoffte Widrigkeiten
komplexerer Ausrüstungen! Und für knapp 130 Euro gibt es
ein astronomietaugliches Fernglas, das 15x70 LE
von TS-Optics.
1.2 Frustrationstoleranz
Frustrationstoleranz heißt zunächst einmal: Bescheidenheit.
Selbst wenn man es endlich geschafft hat, einen famosen
Nebel zu sehen "mit eigenen Augen": Er oder sie sieht nicht
so aus wie auf den Fotos, die das Smartphone in der
Astronomie-App zeigt. Oder gar die Fotos bei "Spektrum der
Wissenschaft", "National Geographic" und anderen. Er oder
sie ist grau und unscheinbar. Denn die Augen sehen bei Nacht
nun einmal vorwiegend Grautöne. Ein anderer Grund sind die
Überlagerung der Farben durch Lichtverschmutzung und
sonstige optisch relevante Effekte. Wer nicht bescheiden
bleiben möchte, der versucht, mit Filtern den Farben
aufzuhelfen. Mit weiterhin eher bescheidenen Ergebnissen,
was die Farben betrifft. So landet er oder sie früher oder
später zwangsläufig bei der Astrofotografie. Denn mit der
kanns dann richtig psychedelisch werden, so wie wir das von
den Nebelbildern aus den Magazinen kennen.Und dann ist die Galaxie endlich im Fokus, aber nur ein schwacher Nebelfleck. Auch nicht so berauschend wie auf den Fotos. Und überstrahlt vom Mond, der gerade aufgegangen ist. Da steigt schnell die Verführung auf, mit einem Griff in die Haushaltskasse das erträumte Bild mit einer lichtstärkeren Optik zu kaufen. Die nebenbei allerdings auch das Mondlicht besser sammelt. Und Vorsicht - die nächste Frustration könnte beim Auf- und Abbau und beim Transport dieses Galaxien-tauglichen Gerätes lauern. Das ist nämlich voluminös und schwer und unhandlich. Erst mal die Erwartungen runterschrauben ist ein guter Tipp für den Start. Denn zunächst werden wir - abgesehen von den Sternen und den Planeten - vor allem mehr oder weniger helle graue Flecken sehen, die berühmten "Wattebäusche", mit denen zu leben wir lernen müssen. Und irgendwann freuen wir uns, bescheiden, wenn wir da, wo wir vorher nichts gesehen haben, einen Wattebausch entdecken, die gesuchte Galaxie.
Frustrationstoleranz ist auch sonst vonnöten, nicht nur weil das Gesehene vom Erwarteten abweicht. Da ist die Ausrüstung aufgebaut, und dann zieht der Himmel zu - obgleich der Wetterbericht anderes gesagt hatte. Da fällt die Powerbank aus und die Montierung lässt sich ohne Strom nur in einer Ebene bewegen, den Rest muss ein Umstellen des Stativs besorgen. Da funktioniert endlich die kabellose Steuerung mit einer der inzwischen heruntergeladenen drei Applikationen (Apps/Programme/Softwares) und dann zieht eine Gruppe von Jugendlichen mit ihren Smartphones auf die Bank neben dem Standplatz und die WiFi-Verbindung zum Teleskop bricht ab. Nun muss das Alignment von vorne beginnen, nachdem man die Jugendlichen gebeten hat, den Lagerplatz um einige Meter zu verlegen - oder selber umgezogen ist. Und inzwischen ist das, was man anschauen wollte, in heller Horizontnähe, im Mondlicht oder sonstwohin verschwunden. Auch da helfen nur Gelassenheit und Flexibilität. Oder, wie Urs Flükiger auf seiner beachtenswerten Website "ursusmajor.ch" als 1. Gebot der Hobbyastronomie drastisch ausführt: "Astronomische Beobachtung ist Masochismus."
Eine Grundqualifikation von Amateurastronomen, die zur Frustrationstoleranz gehört, ist die Bescheidenheit. Das klingt zunächst seltsam bei einem Hobby, das nach den Sternen greift. Aber es ist die Eigenschaft, die einen geübten Betrachter etwas sehen lässt, wo der Einsteiger nichts sieht, zumindest nichts, das er bemerkenswert fände. Daher ist Vorsicht geboten, wenn irgendwo steht, die Galaxie X oder der Nebel Y sei schon mit einem Fernglas oder einem kleinen Teleskop "zu sehen". Oft ist da nur ein kleiner Nebelfleck, eine kaum zu ahnende Helligkeit, ein Pünktchen , ein Flackern zu sehen. Aber wer kennt, was er da sieht, sieht es eben auch als dieses. Der Einsteiger, die Einsteigerin sieht das erst nach Übung und mit herabgeschraubten Erwartungen.
Und ehe ich es vergesse noch etwas, das nicht in den Verkaufsprospekten steht: Teleskope benötigen eine Aufwärm- oder Abkühlzeit im Freien, eine Anpassung an die Umgebungstemperatur, um korrekt zu funktionieren. Erfahrungswerte schwanken zwischen 15 Minuten und zwei Stunden, abhängig vom Gerät und von der Temperaturdifferenz zwischen Aufbewahrungsort und Betrachtungsort, die vor allem im Winterhalbjahr beträchtlich sein kann. Das Scharfstellen oder eine Kollimation sollten danach erst stattfinden. Sonst gibts wieder mal: Frustrationen.
1.3 Sehen lernen
Das "Sehen" in der Astronomie hat zwei Dimensionen.
Einmal die "innere" von Auge und Gehirn, dann die der
äußeren Bedingungen, des "Seeings", das nicht nur in der
professionellen Astronomie eine sehr große Rolle spielt.
Die erste Hürde für Anfänger ist, überhaupt etwas im
Okular zu sehen. Je nach Position des Auges sehen wir
zunächst vielleicht nur die Okularinnenwand. Also Schwarz.
Es muss lange ausprobiert und immer wieder korrigiert
werden, bis allmählich der richtige Einblick "sitzt",
abhängig auch vom jeweiligen Okular. Ein anderes
"Schwarzsehen" kann daher kommen, dass wir gerade
tatsächlich ins Schwarze schauen, in einen
Himmelsausschnitt, wo es keine Sterne gibt - zumindest
keine, für die das eigene Objektiv lichtstark genug ist.
Das kann vor allem bei hohen Vergrößerungen mit
entsprechend kleinem Bildausschnitt und kleiner
Austrittspupille passieren. Zu Beginn sollte man ein 25mm
Okular oder länger einsetzen, da ist der Ausschnitt
in der Regel groß genug. Auch groß genug, damit ein
anvisiertes Objekt nicht gleich wieder aus dem Bild
rauscht. Hilfreich ist es gelegentlich auch, nicht
einzelne Lichtpunkte oder den erwarteten Ort des Objekts
der Begierde zu fixieren, sondern "ins Schwarze" ringsum
zu schauen, also am Zielobjekt "vorbei". Und plötzlich
zeigt sich da etwas, weil die Pupille weiter aufgeht oder
der Blinde Fleck der Netzhaut passend verschoben wird.
Was wir sehen, wird nicht nur von unseren Augen gemacht,
das Gehirn ist daran wesentlich beteiligt, auch durch
Lernen. Dass wir die Welt aufrecht sehen, verdanken wir
unserem Gehirn und anderen Sinnesorganen, denn das Auge
produziert auf der Netzhaut zunächst ein kopfstehendes
Bild. Zwei besondere Leistungen vollbringt das
Zusammenspiel von Augen und Gehirn für den Astronomen. Zum
einen korrigiert es kurzzeitige "Bildstörungen" - durch
Luftturbulenzen etwa. Zum anderen erhöht es bei längerem
Schauen den Kontrast zwischen schwach leuchtenden Objekten
und ihrem Umfeld. So können sich vermeintliche "Nebel"
unversehens in ein Gewimmel von Sternen auflösen. Dazu
kommt als dritter Effekt im Zusammenspiel von Erinnerung
und aktuellem Anblick oft ein fast fotografisch klarer
Anblick, bei dem man sich fragt, wie der plötzlich möglich
ist. Allerdings benötigt dieser Effekt Übung und über
längere Zeit anhaltendes wiederholtes Betrachten der
gleichen Objekte.
Für Anfänger in der Astro-Fotografie kommt es so
gelegentlich zu der überraschenden Erfahrung, dass die
Aufnahmen schlechter sind als das mit dem Auge Gesehene.
Das Gehirn korrigiert kleinere "Bildstörungen", die von
der Kamera bei Langzeitbelichtung gnadenlos aufgezeichnet
werden.
Gutes "Seeing" erfordert eine klare Nacht ohne
strahlenden Vollmond (falls man nicht gerade den Mond -
dann aber mit Filter - betrachten möchte) und eine geringe
Lichtverschmutzung. Störend für das Seeing sind auch
Luftturbulenzen, vor allem durch allgemeine atmosphärische
Störungen bei Betrachtung in Horizontnähe, aus geheizten
Räumen nach draußen oder durch Turbulenzen über
wärmeabstrahlenden Häuser oder gar aktiven Kaminen. Es
kann aber auch Turbulenzen im Teleskoptubus selbst geben,
etwa durch Erhitzung bei Tagbeobachtungen.
Die Hauptjahreszeit für Himmelsbeobachtungen ist das
Winterhalbjahr. Im Sommer verschwindet die Sonne zu spät
für die meisten Berufstätigen, um eine passende Zeit in
der Nacht zu finden. In nördlichen Breiten bleibt oft die
ganze Nacht über zu viel Restlicht der Sonne. Verschärft
wird das Problem noch durch die Sommerzeit, die um eine
Stunde verschoben ist gegenüber dem Sonnenstand. Die Uhr
zeigt schon Mitternacht, obgleich der Sonnenstand erst bei
23 Uhr angekommen ist - mit dem entsprechenden Restlicht.
Gelegentlich kommt es, vor allem für Neulinge, zu einem
Seeing, das schlicht zu gut ist! In den Bergen können wir
schon mal erschlagen werden von der Fülle an gleisend
flirrenden Sternen, die uns orientierungslos machen. Da
hilft, kaum zu glauben, fürs erste eine Sonnenbrille. Eine
Planetariums-App kann uns dann zeigen, wo wir da oben
gerade sind mit den Augen.
Neben dem "Seeing" hat auch das oft vernachlässigte
"Standing" Einfluß auf die Bildqualität. Ein wackelndes
Stativ, naher Schwerlastverkehr oder Windkraftanlagen
können das Bild vor allem bei hoher Vergrößerung zum
Wackelpudding machen. Manchmal ist es aber auch nur die
eigene Hand, die gedankenverloren auf dem Tubus liegt und
diesen in Schwingung versetzt.
1.4 Bastelfreude
Auch wer nicht gleich selber eine Teleskop bauen möchte, sollte eine Neigung zum Basteln mitbringen. Bei diesem Hobby ist die Ausrüstung nämlich nie fertig - was ähnlich von anderen Hobbys gilt, hier aber schon zur Essenz gehört. Das kann schon gleich nach dem Kauf passieren. Auch bei "Komplettausstattungen" für mehrere tausend Euro.Ich habe einmal ein Celestron-Set aus Maksutov und GoTo-Montierung gekauft (unter tausend Euro allerdings) und da war Folgendes zu tun: Der Stromanschluss hatte einen Wackelkontakt. Die Montierungsverkleidung stand spaltbreit offen. Die Softwares von Motorensteuerung und Handbedienung waren nicht aufeinander abgestimmt. Den Sucherfuß musste ich an der Halterung manipulieren, um eine anständige Ausrichtung hinzubekommen. Und die Optik war nicht ordentlich kollimiert. Bei einem Unistellar-Gerät für mehrere tausend Euro ist die Gummiabdichtung am Okular mit der Schere zurechtgeschnitten und wenn man nicht aufpasst, hat man sie beim Abnehmen der Abdeckung halb rausgezogen. Das kann doch nicht sein? Es kann!
Ausrüstungsgegenstände bei diesem Hobby sind oft multifunktional, Anschlüsse haben mehrere Gewinde und eine Steckhülse kann man dort auch noch festklemmen. Alles ist kombinierbar, aufschraubbar, umbaubar. Herrlich! - wenn man das mag und damit umgehen kann. Und nicht gleich denkt, das kann doch nicht sein, wenn eine Steckhülse reingeschoben werden soll, wo ein Innengewinde zu sehen ist. Oder wenn das Batteriefach am Sucher auch auf den zweiten Blick nicht verrät, wie es zu öffnen ist (stabile Fingernägel oder zwei Schraubenzieher). Bei Teleskopen und Suchern, Montierungen und Fokussierern, Okularen und Handbedienungen, Astro-Kameras und Kabeln ist vieles möglich, muss alles ausprobiert und manches nachgefragt/recherchiert werden und im Zweifelsfalle auch: Geschraubt und neu kombiniert. Und Adapter gibt es zahlreich, um die Multifunktionalität weiter zu steigern. Selbst bei den großen Herstellern ist noch viel zu spüren von der Leidenschaft und dem Ideenreichtum der Garagenwerkstatt hinter diesem "Hobby", auch von der Leidenschaft für die Improvisation.
Und wenn im Händlerprospekt steht: "Auspacken und Loslegen!", dann ist damit gemeint: Loslegen mit Ausprobieren, Lernen, Rumrätseln und Basteln! Die Sterne stehen auch in ein paar Wochen noch da, keine Eile!
1.5 Suchen und Finden
Teleskopieren bedeutet vor allem Suchen. Es sei denn, man
hat GoTo mit Autoalign. Aber auch dann ist noch vom Erlebnis
des Suchens etwas zu ahnen, da man dem Teleskop beim Suchen
zuschauen kann. Und immer ist noch nachzubessern und mit der
Vergrößerung zu arbeiten, ist zu Zentrieren und zu Schärfen.
Dennoch plädiere ich dafür, die Erfahrung des Suchens nicht
vorschnell an die elektronischen Assistenten abzugeben.
Schon gar nicht, wenn wir Kindern die Astronomie nahebringen
wollen. Eine der schönsten Erfahrungen für mich war, als ich
meiner Patentochter und ihrer Freundin mit einem Spektiv
80/480 auf einem schlichten Cullmann-Stativ den Jupiter und
den Saturn zeigte. Mit bloßen Augen sahen wir die beiden
rasch, doch ohne Struktur, ohne Monde, ohne Ringe. Bis wir
sie dann im Spektiv hatten, welch eine Mühe! Und welch
unermessliche Freude, als wir sie dann mit ihren
Besonderheiten im Okular sahen. Wir hüpften alle Drei vor
Freude!Dieses Finden nach langer Suchen ist wie der Blick auf ein Bergpanorama nach langer Wanderung. Wie der tiefer ist als der Ausblick nach einer Gondelfahrt, so vertieft auch das Suchen die Erfahrung des Findens in der Astronomie. Ich möchte damit die "Gondelfahrt" nicht schlecht reden, aber wer es (noch) kann, der sollte es immer wieder einmal ohne versuchen. Die Electronically Assisted Astronomy/EAA bietet wundervolle Möglichkeiten, zumal für die Astrofotografie. Gerade Anfänger in der Astronomie sollten sich aber nicht um die Erfahrung bringen lassen, auch mit eigenen Augen zu suchen, manuell an- und nachzufahren, zu rätseln und aus Irrtümern zu lernen.
Ein bisschen ist es beim Teleskopieren - ohne elektronische Unterstützung - wie mit der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Aber im Unterschied zur Nadel wissen wir von unseren Suchobjekten, wo wir sie finden (sollten). Wir haben Spuren, Wegzeichen, Koordinaten. Und wir können lernen, immer besser zu werden beim Finden. Dieser Prozess ist unschätzbar bereichernd, belehrend und erweiternd. Das Fernglas hilft uns dabei - und einfache Techniken wie das Starhopping (siehe weiter unten).
Und oft müssen wir uns lange damit begnügen, zu wissen, wo ein Objekt steht, es nicht zu sehen dort, wo es ist, in das vermeintliche Nichts zu schauen, aus dem es dann irgendwann einmal - oft unvermittelt - auftaucht. Diese Erfahrung, an einem einzelnen Objekt, ist wertvoller als das Abklappern einer langen Objekteliste mit einer "perfekten" Ausrüstung.
2
Grundentscheidungen beim Teleskop-Kauf
Vor einem Ausrüstungskauf sollten einige Grundentscheidungen klar sein. In den Foren und bei den Shops wird vor allem darauf hingewiesen, dass für Astrofotografie nur bestimmte Teleskope und Montierungen tauglich seien. Und sicherlich ist dies eine der wichtigsten Vorentscheidungen: Will ich auch fotografieren mit meiner Ausrüstung? Dabei ist nicht gemeint, mal schnell ein Foto vom Mond oder vom Jupiter zu machen - das geht mit allen Ausrüstungen, indem man statt des Auges die Linse des Smartphones ans Okular hält - gegebenenfalls mit einer entsprechenden Montierung, die allerdings nicht notwendig ist fürs gelegentliche Knipsen. Anspruchsvolle Astrofotografie ist mehr, sie umfasst Langzeitbelichtungen, dazu notwendig die Verfolgung der Objekte mit einer geeigneten Montierung und Steuerung, und/oder das Übereinanderlegen verschiedener Aufnahmen mit dem sogenannten "Stacking", einem digitalen Verarbeitungsprozess. Wer das möchte, muss sich darüber im Klaren sein, dass es 1. schon eine schier unübersehbare Fülle wunderbarer astronomischer Aufnahmen gibt, im Netz, in Printpublikationen, bei wissenschaftlichen Einrichtungen, in Sternwarten, auf zahllosen privaten Festplatten. Und dass diese Hobby-Ergänzung 2. nochmals viel Zeit kostet! Dass sie auch beglückt, steht außer Frage. Und wer zum Jäger-Sammler-Typus der Hobby-Astronomenzunft gehört, der wird ohne fotografische Dokumentation nicht auskommen wollen.
Fragen sollte man sich auch, ob eher Sonne, Mond und die Planeten im Fokus stehen sollen oder lichtschwache Deep-Sky-Objekte. Aber wie soll man das entscheiden, wenn man noch gar nicht so genau weiß, wohin die Reise gehen wird? Da hilft es, vor dem Kauf eines teuren Teleskops schon mal mit einem guten Fernglas oder einem Spektiv zu beginnen. Oder zumindest mit einem schlichten Teleskop ohne alle Erweiterungen zu starten. Aber nicht auf einem wackeligen Stativ, das verdirbt die Freude! Ob man dabei eher manuell steuern möchte oder mit digitaler Unterstützung, ist auch eine Frage des Typus. Wem vor dem Umgang mit Smartphone und Laptop am Beobachtungsplatz in stiller Nacht graut, der sollte erstmal manuell einsteigen. Da gibt es ordentliche und preisgünstige Geräte, deren Anschaffung später beim Umstieg nicht so reut wie der Kauf einer teureren GoTo-Ausrüstung, die sich zügig als eine Nummer zu klein erweist und dann verstaubt nach dem Kauf der persönlich tauglicheren Ausrüstung ein bis zwei Preisklassen darüber.
2.1 Parallaktisch versus azimutal
Viele Anfänger fürchten sich vor der parallaktischen Montierung (die Montierung ist das Verbindungsstück zwischen Stativ und Teleskop), da diese mit Einstellungsgeheimnissen schreckt. Wer allerdings schon eine Winternacht mit einer azimutalen GoTo-Montierung rumgefummelt hat oder einen Dobson manuell einem Planeten hinterherschubste, der ist reif für die Parallaxe. Und auch Anfänger sollten sich nicht abschrecken lassen, wenn sie von der Peilung zum Himmelspol, von Polhöhe, Gegengewichten und anderem mysteriösem Geraune im Zusammenhang mit parallaktischen Montierungen hören.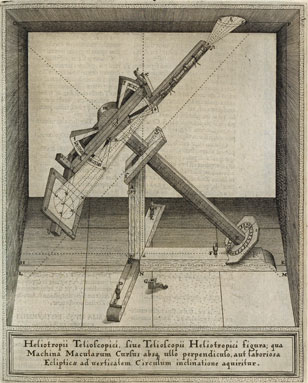
Die parallaktische (oder äquatoriale/EQ-) Montierung folgt der Tatsache, dass der Sternenhimmel sich um eine Achse dreht, nämlich die verlängerte Erdachse, die am Himmelspol gleichsam die Himmelskuppel durchstößt. Die vermeintliche Rotation des Sternenhimmels entsteht schlicht durch die Drehung der Erde um eben diese Achse. Daher kommt die parallaktische Montierung bei der Nachführung von Sternen mit einer Achse aus, die der Erdachse entspricht, zu dieser parallel ist, der Rektaszensionsachse (Stundenachse). Allerdings besitzt sie für die Einstellung auf ein bestimmtes Himmelsobjekt noch eine zweite, im rechten Winkel dazu stehende Achse, die Deklinationsachse. Diese wird nach der Einstellung auf ein Objekt fixiert und das Teleskop in der Nachführung um die Rektaszensionsachse gedreht, dem Objekt bei seiner - vermeintlichen - Wanderung folgend, in Wirklichkeit die Erddrehung ausgleichend. Den ersten Ansatz zu einer parallaktischen Montierung finden wir um 1610 für das Heliotrop im "Turm der Winde" des Vatikans zur Sonnenbeobachtung (s. Abbildung rechts).
Bei der azimutalen Montierung gibt es zwei Bewegungsachsen, die bei der Nachführung beide aktiv sein müssen, um die Vertikale drehend (im Azimut) und um die Horizontale drehend (in der Höhe/Altitude/Elevation), die gleichfalls im rechten Winkel zueinander stehen. Die azimutale Montierung ist technisch weniger aufwendig, weniger sperrig und stabiler. Für schwere Teleskoptuben sind azimutale Montierungen wesentlich billiger zu bekommen als parallaktische. In den unteren (leichteren) Teleskop-Preisklassen dominiert jedoch die parallaktische Montierung. In der Handhabung ist die azimutale Montierung zweifellos einfacher. Die Nachführung ist jedoch ungenauer, manuell wie elektronisch, daher ist diese Montierung für die Astrofotografie weniger geeignet.

Beide Montierungen, parallaktische wie azimutale, können auch digital über Motoren gesteuert werden. Sie können also Objekte nach entsprechender Justierung ("Alignment") eigenständig ansteuern über Computer, Smartphone oder integrierte Steuerungseinheit und diesen Objekten folgen. Dabei arbeitet die parallaktische Montierung wesentlich genauer als die azimutale, da nur auf einer Achse nachgeführt werden muss, weshalb für die Astrofotografie eigentlich nur sie in Frage kommt. Es gibt allerdings auch sehr gute Bildergebnisse mit azimutalen Montierungen bei entsprechender Nachrüstung durch eine Polhöhenwiege und andere technische Maßnahmen wie Bildbearbeitung.
Ein Sonderfall der azimutalen Montierung ist die Rockerbox, die für Dobsons (= Newtons, die auf dem Boden oder auf dem Tisch stehen) entwickelt wurde, die aber auch behelfsweise andere Tuben tragen kann. Sie ist besonders stabil, kann allerdings nicht so fein geführt werden. Ihre Bewegung erfolgt durch das bekannte "Schubsen" sobald das Objekt am Rand des Bildfeldes angekommen ist. Die Rockerbox ist Stativ und Montierung in einem, da Dobsons auf dem Boden oder (kleinere) auf einem Tisch stehen. Motorensteuerung ist auch hier möglich. Eine erste Idee zur Rockerbox zeigt die Montierung des Herschel-Teleskops von 1790 im Teylers-Museum Haarlem (s. Abbildung links).
Die Entscheidung zwischen den beiden Montierungstypen ist also verbunden mit den Entscheidungen für oder gegen (und ggf. für welche) Astrofotografie und für oder gegen elektronische Nachführung - und abzustimmen mit dem vorgesehen Zeit- und Finanzmittelbudget. Aber da Hobby-Astronomen Tüftler und Bastler sind, werdet ihr auch Dobson-Fans finden, die auf Astrofotografie mit dem Dobson und händische Nachführung schwören - die digitale Bildbearbeitung regelt dann alles! Es geht eben bei der Entscheidung zwischen den Systemen auch ums "Gefühl", um persönliche Vorlieben, um das Handling, die Ästhetik, den Symbolgehalt, das umgreifende Narrativ.
2.2 Brennweite versus Öffnung
Die Brennweite einer Teleskop-Optik bestimmt die mögliche
Vergrößerung. Je länger die Brennweite, um so höher
die mögliche Vergrößerung, die auch abhängig ist von
der Brennweite des Okulars - des Teils beim Auge des
Betrachters. Die Vergrößerung ergibt sich aus "Brennweite
Tubus" : "Brennweite Okular". Also große
Objektiv-Brennweite verbunden mit kleiner Okularbrennweite
ergibt besonders hohe Vergrößerung. Die Öffnung des
Objektivs, des Teleskop-Auges, bestimmt den erfassten
Lichteinfall und damit die Fähigkeit des Teleskops, auch
lichtschwache Objekte sichtbar werden zu lassen und eine
gute Auflösung der Objekte zu liefern. Je weiter die
Öffnung, umso besser können lichtschwache Objekte wie
Galaxien erfasst werden.
Beide Faktoren bestimmen wesentlich die Größe und das
Gewicht einer Ausrüstung. Und zwar nicht nur über Größe
und Gewicht des Teleskops, sondern in der Folge auch über
die notwendige Stabilität von Montierung und Stativ (bzw.
Nachführplattform beim Dobson), die sich gleichfalls im
Gewicht niederschlägt.
Wer Planeten beobachtet, benötigt eine anständige
Vergrößerung, aber auch eine hinreichende Auflösung, um
Oberflächenstrukturen zu erkennen. Wer Deep Sky Objekte
betrachtet, der ist vor allem auf eine große Öffnung mit
entsprechender Lichtaufnahme angewiesen. Eine besonders
hohe Brennweite ist da eher hinderlich, da sie den
Bildausschnitt verkleinert und die Lichtstärke reduziert.
Eine große Brennweite und damit hohe Vergrößerungswerte
sollten in der Amateuer-Astronomie nicht zum Fetisch
gemacht werden. Denn Vergrößerungen ab 300fach führen zu
einer sehr hohen Anfälligkeit für atmosphärische
Bildstörungen und leichteste Erschütterungen. Das kennen
wir bereits vom Blick durch Ferngläser: Je größer der
Vergrößerungsfaktor, umso ruhiger muss unsere Hand sein,
um noch genußvoll betrachten zu können. Schon ab 10facher
Vergrößerung empfiehlt sich beim Fernglas - je nach
Handruhe - die Verwendung eines Stativs oder zumindest
einer stützenden Unterlage. Im übrigen benötigen die
meisten interessanten Himmelsobjekte keine sonderlich hohe
Vergrößerung - und manche Sternhaufen, galaktischen Nebel
oder Galaxien sind mit Vergrößerungen bis 50-fach am
besten zu betrachten!
Die sinnvolle Vergrößerung hängt auch entscheidend ab
von der Öffnung des Teleskops. Je größer die
Öffnung, umso höher kann man auch bei der Vergrößerung
ohne Qualitätsverlust gehen. Denn hohe Vergrößerung
bedeutet zunehmende Dunkelheit und ab einem bestimmten
Grad auch Unschärfe. Als Faustregel kann gelten, dass die
maximale komfortable Vergrößerung etwa dem
Objektivdurchmesser entspricht (die Austrittspupille
beträgt dann allerdings nur noch 1mm!). Angegeben wird
allerdings meist der doppelte Wert. Letztlich hängt der
Wert auch ab vom Betrachtungsobjekt. Lichtstarke Objekte
(die großen Gasplaneten z.B.) ertragen, ja verlangen oft
hohe Vergrößerung.
So erlaubt z.B. eine Brennweite von 900 mm bei einer
kleinen Öffnung von 60 mm (Öffnungsverhältnis 1:15) nur
geringe Vergrößerungen, auch wenn theoretisch mit einem
6mm-Okular eine Vergrößerung von 150fach möglich wäre, mit
2fach-Barlow 300fach - was das Bild dann aber unbrauchbar,
diffus und dunkel macht. Umgekehrt lässt eine Öffnung von
200 mm viel mehr Vergrößerung zu bei einer kleineren
Brennweite von 800 (Öffnungsverhältnis 1:4) - hier könnte
sogar ein Okular mit 4mm eingesetzt werden für eine
200fache Vergrößerung. Solche Optiken - mit kleinem
Öffnungsverhältnis - sind wahre "Lichtmaschinen" und für
die Astrofotografie optimal. Sie werden auch "schnelle"
Optiken genannt, da sie beim Fotografieren kürzere
Belichtungszeiten benötigen.
Ein gängiges Bonmot unter Astronomen lautet daher: Es
gibt drei relevante Faktoren für ein gutes Teleskop, 1.
Öffnung, 2. Öffnung, 3. Öffnung! Ein anderer Spruch
lautet: "Nichts ersetzt Öffnung - außer mehr Öffnung!" Was
von Tagbeobachtern allerdings aus nachvollziehbaren
Gründen nicht unterschrieben wird.
Hohe Vergrößerungen sind empfindlich für atmosphärischen
Störungen (die bei Horizontnähe am größten sind, weshalb
hier geringere Vergrößerungen gewählt werden sollten) und
eine große Öffnung sammelt auch die Lichtverschmutzung,
das Restlicht der Sonne oder eventuelles Mondlicht. Für
den häuslichen Balkon oder Garten ist eine besonders
lichtstarke und/oder vergrößerungsstarke Ausrüstung in
der Regel Verschwendung oder gar kontraproduktiv!
Daher muss eines immer klar bleiben: Der Beobachtungsplatz
ist der wichtigste Faktor, dann folgt das eigene
Sehvermögen, die Übung im Betrachten - und dann erst kommt
der Wert der Ausrüstung! Wer die ersten beiden Faktoren
durch die Ausrüstung kompensieren möchte, wird
zwangsläufig enttäuscht werden und Geld zum Fenster hinaus
werfen! Und er/sie bringt sich um die bereichernde
Erfahrung des "am Himmel" Sehen Lernens!
2.3 Refraktor versus Reflektor
Refraktoren ("Brecher") sind Linsenteleskope, die einen direkten Weg des Lichtes vom Objektiv zum Okular haben. Reflektoren sind Spiegelteleskope, die das Licht vom Hauptspiegel wieder zurück in Richtung Objektiv werfen, wo es vom Fangespiegel aufgenommen und zum Okular hin gelenkt wird. Der hohen Kosten für farbgenaue, lichtstarke Linsensysteme wegen dominieren heute die Reflektoren den Markt für Amateurteleskope.
Refraktoren sind kontrastreicher, da der Lichtweg
direkter ist als bei den Reflektoren. Sie haben keine
"Obstruktion", keinen Lichtverlust durch den Fangspiegel.
Daher sind sie bei detailreichen Objekten (Planeten z.B.)
brauchbarer, haben aber in billigeren Ausführungen
Farbfehler, Farbsäume, bedingt durch die Brechungen in den
Linsen, die mit der Vergrößerung zunehmen. Reflektoren
bringen mehr Licht für weniger Geld. Sie sind bei
lichtschwächeren Himmelsobjekten (Nebel, Galaxien) von
Vorteil. Sie haben die Nachteile, dass sie
kontrastschwächer sind und die Spiegel beim Transport
verruckeln können und nachjustiert werden müssen.
Historisch kamen nach bisherigem Wissenstand im
astronomischen Einsatz die Refraktoren vor den
Reflektoren, mit dem ersten Linsenteleskop des
holländischen Brillenmachers Hans Lipperhey von 1608,
zügig nachgebaut von Galileo Galilei 1609. Linsenteleskope
haben ihren Einblick am unteren Teil des Rohres, was die
Handhabung (außerhalb von Observatorien) bei größeren
Dimensionen schwierig macht. Ihre Herkunft von der Brille
läßt sich schwerlich verkennen. Über die Nutzung optischer
Gläser zur Betrachtung des Mondes spekulierte im Übrigen
bereits Leonardo da Vinci.
Der erste Reflektor wird landläufig Newton zugesprochen,
mit seinem 6'' Fernrohr von 1668. Allerdings hatte der
italienische Jesuit Niccolò Zucchi bereits in seiner
"Optica philosophia" von 1652 berichtet, er habe 1616 ein
Teleskop mit sphärisch gewölbtem Spiegel gebaut. Zucchi
könnte inspiriert gewesen sein durch den in der
Renaissance neu entdeckten Mathematiker Heron, der im 1.
Jahrhundert unserer Zeitrechnung in Alexandria am Museion
lehrte. Heron konstruierte unter anderem optische
Instrumente mit parabolischen Spiegeln, basierend auf den
Lichttheorien von Diostheus und Diocles. Bei da Vinci gibt
es schon 1512 recht deutliche Hinweise auf die Nutzung
eines Hohlspiegels für die Himmelsbetrachtung. Der erste
parabolische Hauptspiegel (parabolisch bringt eine bessere
Abbildung als sphärisch) für ein Teleskop wurde 1721 von
den Gebrüdern Hadley produziert. Newton-Teleskope haben
den Einblick oben, beim Objektiv.
Inzwischen gibt es zahlreiche weitere gebräuchliche Typen von Reflektoren, neben Newtons sind vor allem wichtig geworden Schmidt-Cassegrains und Maksutovs. Diese haben ein mittiges Loch im Hauptspiegel (geht zurück auf Laurent Cassegrain, 1629-1693), durch welches das Bild vom Fangspiegel in das dann wieder, wie bei den Refraktoren, unten liegende Okular gelangt. Sie werden mit Zenitspiegel oder Amici-Prisma beim Okular zur Einblickumlenkung verwendet oder in Sternwarten auch mit Direkteinblick.
Ein Sonderfall der Reflektoren ist der Schiefspiegler.
Hier befindet sich der Fangspiegel nicht im primären
Lichtweg, vor dem Hauptspiegel, sondern seitlich am Tubus.
Der Hauptspiegel ist leicht geneigt und wirft das Licht
durch eine Öffnung im Tubus nach außen, wo der gleichfalls
leicht geneigte Sekundärspiegel/Fangspiegel das Licht in
einem kleineren Tubus zum Okular führt. Damit hat der
Schiefspiegler - wie ein Refraktor - keine Obstruktion.
Schiefspiegler werden kaum mehr produziert, es gibt aber
gebrauchte ältere Modelle oder Einzelanfertigungen.
2.4 Manuell versus GoTo
Wer mit hoher Vergrößerung schaut, wundert sich, wie zügig
die Objekte aus dem Bildfeld verschwinden. Durch die
Eigendrehung der Erde "bewegt" sich der Sternenhimmel von
Ost nach West, wie auch die Sonne. Der Mond und die Planeten
haben dazu noch ihre (für die kurzfristige Beobachtung nicht
signifikante) Eigenbewegung, während die Eigenbewegungen der
Sterne durch die riesige Entfernung nicht erkennbar sind.
Galileo Galilei hat die Rotation des Sternhimmels noch durch
die freihändige Bewegung seines Teleskops von 1609
ausgeglichen. Zügig wurden jedoch die ersten drehbaren
Halterungen entwickelt, die das Verfolgen der Himmelsobjekte
vereinfachten. Newtons 6'' Teleskop von 1668 ruhte bereits
auf einem hölzernen Kugelkopf mit allseitiger Beweglichkeit.Viele Hobby-Astronomen schwören auch heute noch auf die manuelle Führung des Teleskops, vor allem Dobson-Benutzer. Die Rockerbox zur Führung der Dobsons wird "geschubst" ("to rock" - schütteln, schieben, wackeln), am feinsinnigsten arbeiten parallaktische Montierungen. Und dazwischen liegt ein großes Spektrum mehr oder weniger leicht zu handhabender Montierungen.
Elektromotoren haben die Führung weiter erleichtert. Sie wurden zunächst für größere Teleskope eingesetzt, sind inzwischen jedoch auch im Hobbybereich weit verbreitet, auch bei Dobsons, wo gerne darauf hingewiesen wird, eine bestimmte Motorensteuerung "bewahre das spezifische Dobson-Feeling". Mit den Motoren sind kontrolliertere Bewegungen möglich als mit manueller Führung. Motoren machten auch eine Fernbedienung realisierbar und schließlich das automatisierte Aufsuchen von Objekten und die Steuerung durch Programme, die die Positionsveränderungen durch die Erdrotation oder planetare Eigenbewegungen kompensieren und so die längere Betrachtung sowie Langzeitbelichtungen in der Astrofotografie wesentlich erleichtern.
Eine GoTo-Steuerung des Teleskops hilft nicht nur beim Nachführen, sondern auch beim Auffinden der Objekte. Vor dem Auffinden und Nachführen muss die Steuerung jedoch erst auf den jeweiligen Standort und den entsprechenden Himmelsanblick eingestellt werden. Dies nennt man "Alignment". Es gibt je nach Montierung, Teleskoptyp, Hersteller, Steuerungstechnik, Beobachtungsziel, Genauigkeitsanspruch sehr viele unterschiedliche Alignment-Prozeduren, weshalb ich hier von einer Darstellung absehen muss.
Eine Software kann nach dem Alignment, also der Justierung in Relation zum aktuellen Sternenhimmel, das Teleskop über die Motorensteuerung zu jedem beliebigen im Datenbestand der jeweiligen Software eingespeisten Himmelsobjekt führen. Dies ist das eigentliche "GoTo" ("Gehe Zu"). Auch die Nachführung zur Ortsveränderung der Sterne durch die Erdbewegung oder zur Ortsveränderung der Planeten (bei längerer Beobachtung) wird von der Software übernommen.
In den Prospekten klingt das immer ganz super, in der Praxis gibt es immer wieder Abweichungen im Auffinden der Objekte (knapp daneben ist mit einer hohen Vergrößerung schnell ganz daneben) oder Fehlleistungen bei der Nachführung (ruckartig, ungenau, gar nicht). Hier heißt es, wir kennen es schon: geduldig sein, Fehler aufspüren, genau arbeiten, mit verschiedenen Softwares und Alignmentprozeduren probieren, nicht aufgeben.
Bei einer GoTo-Montierung sollte darauf geachtet werden, dass diese auch manuell zu bedienen ist, etwa bei Stromausfall oder wenn man gerade mal keine Zeit oder Lust auf ein Alignment hat. Häufig ist bei azimutalen Montierungen mit Motorsteuerung eine manuelle Bedienung (also ohne Motoren) nur in der Höhe möglich. Für die Schwenkbewegungen seitwärts ist man da auf das Verdrehen des Stativs angewiesen, was nicht wirklich praktikabel ist.
2.5 Optisch versus digital
Erinnert sich noch jemand an den Aufruhr, als die
Schallplatte durch digitale Schallträger abgelöst wurde? Wie
der Untergang des Musikgenusses beschworen wurde? Als die
Schreibmaschine durch den Computer abgelöst wurde, bestanden
einige Autoren weiter auf der kreative Potenz der
Schreibmaschine - obwohl sie die Schreibmaschine ungern
durch einen Federkiel ersetzt hätten.Für das Teleskopieren zeichnet sich ein ähnlicher Umbruch schon lange schleichend ab, denn was ist Astrofotografie anderes als der Übergang zur digitalen Himmelsbetrachtung? Die Langzeitbelichtung erfolgt mit digitalen Kameras und immer häufiger mit digital gesteuerter Nachführung, das Stacking legt digitale Aufnahmen übereinander und berechnet daraus ein optimiertes Bild. In einem namhaften deutschen Astro-Forum war Ende 2021 der Satz zu lesen: "Immer mehr unserer Foristen sind außerdem dabei mit Astrocameras für EAA aufzurüsten, um endlich mehr als graue Wattebäusche zu sehen." EAA bedeutet "Electronically Assisted Astronomy". Das Okular wird ersetzt durch eine Kamera und diese kann mit einem Laptop und dieses wiederum mit der Motorensteuerung der Montierung verbunden werden. Ausrichtung auf die Objekte, Nachführung und Bilderzeugung können digital gesteuert stattfinden.
Das Crowd-Funding Projekt eVscope des 2015 in Marseilles gegründeten Startups Unistellar hat 2020 ein Teleskop auf den Markt gebracht, das all dies in das Teleskop selbst integriert. Das Teleskop kennt seinen Standort und weiß, worauf es gerade am Himmel gerichtet ist. Und wir können der "allmählichen Verfertigung" des Bildes zuschauen, als schauten wir unserem Gehirn zu, wie es eine Wahrnehmung präzisiert. Heinrich von Kleist hätte vermutlich seine Freude an diesem Teleskop gehabt.
Wird dadurch die Erfahrung des "mit eigenen Augen sehen" zerstört? Gibt es dann noch einen Unterschied dazu, die Objekte einfach gleich auf der Planetariums-App anzuschauen? Die Frage, was eigentlich an der Astronomie so faszinierend sei, stellt sich spätestens mit diesem Teleskoptyp neu. Und jeder, jede wird eine für sich persönlich gültige Antwort finden müssen vor der Entscheidung für oder gegen den Kauf dieses Teleskops. Wobei allerdings (vorläufig noch) der Preis eine ganz entscheidende Rolle spielen wird. Denn es gibt wesentlich leistungsfähigere "konventionelle" Teleskope als das eVscope für weit weniger Geld. Und aufgerüstet mit EAA-Elementen können diese - mit allerdings höherem Geräte- und Zeitaufwand - alles das auch, was das eVscope kann. Und weit mehr!
Für Sonne, Mond und Planeten ist das eVscope wenig geeignet. Seine optische Vergrößerung geht nur bis auf 50fach. Das erreicht schon ein Spektiv, das nur einen Bruchteil des digitalen Teleskops kostet. Die Stärke des Geräts liegt beim treffsicheren elektronischen Auffinden der Objekte, bei der genußvollen Betrachtung von Nebeln und Galaxien auch auf dem häuslichen Balkon, denn es kann die Lichtverschmutzung "rausrechnen". Und es bringt Farbe ins Bild. Was einige Filter zwar auch - filternd, nicht rechnend - können, aber weit schlechter. Auch die EAA kann das, billiger (gemessen daran, dass jeder eh schon ein Laptop, Pad oder Smartphone hat) aber weniger komfortabel. Bei einem aktuell (Stand Februar 2022) vom Produzenten mit 4.500 Euro aufgerufenen Preis (mit Okular, ohne Okular sind es 1.700 Euro weniger) wird dieses digitale Teleskop vorläufig sicherlich ein Nischenprodukt bleiben und vor allem weniger technisch versierte und engagierte Interessenten ansprechen.
Die Gegenüberstellung optisch-digital sollte nicht zu streng genommen werden, sie soll der Analyse helfen, aber keine falschen Alternativen aufbauen! "Digital" ist auf "optisch" angewiesen und "optisch" geht häufig nicht mehr ohne "digital" für die gewünschten Ergebnisse! Entscheiden muss man sich hier letztlich für den Anteil, den man der jeweiligen Komponente zugestehen möchte. Und wer gerne Sahnetorte isst, der muss ja deswegen nicht auf Vollkornbrot verzichten. Wer sich ein Pedelec kauft, wird vielleicht mit mehr Freude als zuvor auch mal wieder auf sein "normales", leichteres, wendigeres, "sportlicheres" Fahrrad steigen.
when a smaller will answer the purpose."
Friedrich Wilhelm Herschel (1738-1822)
3 Ausrüstung
Die Ausrüstung kommt hier mit gutem Grund erst an dritter
Stelle. Denn das Wichtigste bei der Astronomie sind der
Beobachtungsplatz und die Beobachtungszeit. Fremdlichtarm,
weitgehend ohne Luftturbulenzen, erschütterungsfrei, windarm
(Abhilfe kann ggf. ein Beobachtungszelt bringen) sollten sie
sein. Und bei Einsatz von direktem WiFi sollte der Platz
ohne sonstigen nahen WLAN-Verkehr sein. An zweiter Stelle
stehen das Wissen um die Auffindung geeigneter Objekte, die
Geduld bei der Beobachtung und ein geschultes Sehen. Und
dann erst kommt die Bedeutung der Ausrüstung! Vor jedem Zu-
oder Neukauf solltest du dich daher ehrlich fragen, ob es
nicht geboten wäre, zunächst an den ersten beiden
Stellschrauben zu drehen!Wichtige Vorentscheidungen zur Ausrüstung werden oben erklärt in den Kapiteln 2.1 bis 2.5. Du solltest dir klarmachen, was du mit deiner Ausrüstung realistischerweise anfangen möchtest und wirst. Oft passen die Ansprüche nicht zur Ausrüstung, weshalb vor Neukauf und Erweiterungen genau zu prüfen ist, wie weit das Neue zu den Ansprüchen passt - und ggf. auch zum bereits Vorhandenen. Wer vorwiegend Planeten fotografieren möchte, ist mit einem Dobson schlecht beraten. Umgekehrt ist ein Nebel- und Galaxienjäger mit einem Linsenteleskop auf der falschen Spur. Und wenn das mit großen Versprechungen angepriesene neue Okular gar nicht seine Leistung bringen kann, weil das Objektiv zu lichtschwach oder die Tubus-Brennweite zu kurz oder zu lang ist, macht die Anschaffung keinen Sinn.
3.1 Fernglas
Es mag erstaunen, bei der Teleskopierausrüstung mit dem Fernglas zu beginnen. Aber denken wir daran, als Galileo Galilei am 7. Januar 1610 die ersten drei der Jupitermonde entdeckte, tat er dies mit einem "Fernrohr", das er selbst aus zwei Brillengläsern gebastelt hatte nach dem Modell des Holländers Hans Lipperhey, der 1608 den Prototypen entwickelte. Galileis Fernrohr hatte gerade einmal eine 18-fache Vergrößerung! Damit konnte er unser Bild von der Welt verändern! Das können wir heute nicht mehr so einfach, aber wir können unser persönliches Bild von der Welt außerhalb unseres "Dunstkreises" bereichern, schon mit einem schlichten Fernglas! Und zur Erinnerung auch dies: Charles Messier erstellte seinen Katalog teilweise mit 3-Zöllern, also gerade mal 75mm Öffnung (später benutzte er vor allem einen Gregory-Reflektor mit 190mm). Und das heißt, mit dem Bresser Spezial-Astro 20x80 für 160 Euro sind wir in gewisser Hinsicht schon auf dem Ausstattungsniveau von Galilei und Messier! Wir sollten die Fernglas-Astronomie daher nicht gering schätzen!Ein Fernglas gibt uns in Zeiten der Lichtverschmutzung ein bisschen den Sternenhimmel wieder, wie er noch in den 1950er und 1960er Jahren abseits von Großstädten mit bloßem Auge zu erleben war, mit einer prächtigen "Milchstraße". Es hilft bei der ersten Orientierung am Sternhimmel und vor jeder Sitzung zur Vorbereitung der Objektsuche - wenn wir nicht mit GoTo arbeiten. Sofern die Muße dazu da ist, macht es auch großes Vergnügen, einfach erst einmal den sich gerade bietenden Himmel "abzuglasen", wie Jäger das mit ihrem Revier machen. Allerdings sollten wir dabei noch behutsamer streifen, als Jäger dies tun. Darüberhuschen bringt wenig, da wird vieles "übersehen". Für den Mond und die hellen, größeren Planeten Venus, Mars, Jupiter und Saturn ist ein Fernglas durchaus hinreichend, um erste schöne Seherfahrungen zu machen. Deep Sky Objekte wie die Plejaden (M45) enthüllen ihren Zauber bereits mit einem Fernglas von 8- bis 10-facher Vergrößerung. Mit einem 8x40, 10x50 oder gar 15x70 Fernglas können Sie in einer klaren Bergnacht im Sommer schon ganz komfortabel und ohne Ausrüstungsschlepperei bis in die Welt der Nebel und Galaxien reisen. Manche Sternhaufen sind mit dem 8x40 Fernglas besser zu betrachten als mit dem Teleskop, da sie bei höheren Vergrößerungen als Haufen sich auflösen und der faszinierende Eindruck verloren geht. Auch kleinere Sternbilder zeigen teilweise erst im Glas ihre Struktur, etwa der wunderschöne Delphin. Also einfach ausprobieren!
Neben der Vergrößerung sollte auch die Öffnung beachtet werden. Bei einem Fernglas 10x70 geht für ältere Betrachter allerdings ein Teil der Lichtstärke ungenutzt verloren, da sie von der Austrittspupille 7mm vielleicht nur noch 5mm aufnehmen können. D.h., sie sehen keinen erheblichen Unterschied zu einem 10x50er Glas, schleppen aber das Gewicht und die Ausmaße eines 70mm-Glases! Womit der dritte relevante Zahlenwert genannt ist: das Gewicht! Mancher schwört auf 900 Gramm als Maximalgewicht für die Freihändigkeit, ich halte 1.400 Gramm bei für mich passender Griffigkeit noch für gut haltbar und es gibt Sterngucker, die auch mit 2.400 Gramm frei zurechtkommen. Das ist abhängig von der Bauweise des Fernglases, von der eigenen Konstitution und der Form der Hände, aber auch von der Zeitdauer der freihändigen Benutzung und den Stützmöglichkeiten ("freihändig" sollte nicht zu eng genommen werden). Die beiden wichtigsten Stützmöglichkeiten sind Anlehnen und Aufstützen der Ellbogen.
Ein großer Nachteil von Ferngläsern (abgesehen von den Großferngläsern/Binokularen mit Winkeleinblick) muss unbedingt beachtet werden: Nacken-, Ellbogen- und Schulterschmerzen sind bei längerer Betrachtung ohne Entlastung vorprogrammiert! Hier helfen nur bewusste Entspannung und der Einsatz von Stützen, Anlehnen an ein Gebäude oder einen Baum, zurückgelehntes Sitzen oder auf dem Rücken liegende Betrachtung mit Polstern. Und ggf. Stative oder Aufhängungen. Dabei muss jeder/jede seine/ihre Lösung finden, die den Nacken-/Schulterbereich und die Arme entlastet. Die optimale Lösung ist ein Campingstuhl mit verstellbarer Rückenlehne. Die Lehne sollte hoch genug sein, auch Nacken und Kopf zu stützen. Verstellbar sollte sie fast bis zur Liegeposition sein. Armstützen sind äußerst hilfreich, um die Ellbogen aufzusetzen und mit den Armen einen flexiblen Stativersatz zu bauen. Grundsätzlich gilt: Machen Sie es sich bequem! Und zwar gleich zu Beginn, nicht erst, wenn die Schmerzen beginnen!
Die Fernglas-Astronomie ist auch eine gute Möglichkeit, mit wenig Aufwand und besser integriert in den Alltag mit knappen Zeitfenstern den Sternhimmel zu erfahren. Nicht Fast-Food, aber auch nicht der aufwendige 3-Sterne-Restaurant-Besuch in 60 Kilometern Entfernung. Sondern ein gesunder Salat oder etwas Obst zwischendurch. Und wir können mit dem Fernglas bereits Vertreter aller besonders relevanten Objektgruppen erreichen, Sterne, Planeten, Trabanten, Kometen, Kugelsternhaufen, Offene Sternhaufen und Assoziationen, kleine Sternbilder, Planetarische Nebel, nicht-planetarische Nebel, Galaxien.
Auch unter Semi-Profis der Astro-Szene gewinnt der gerade Fernglaseinblick immer mehr Freunde. Er ist unmittelbar auf den Blick mit den bloßen Augen zu beziehen, ist räumlich, erlebnisintensiv und macht Zusammenhänge erkennbar. Damit will ich nicht gegen das Teleskop sprechen. Ich verdanke dem einäugigen Teleskopblick unvergleichlich eindrückliche Erfahrungen. Beides hat seine Berechtigung - und auch das ganze Feld dazwischen, mit Bino-Aufsätzen am Teleskop, Doppel-Teleskopen, Winkel-Ferngläsern/Binos und Spektiven.
Gerne wird damit geworben, was mit dem Fernglas "schon zu sehen" sei. Aber auch das, was mit dem Fernglas nicht zu sehen ist, lässt sich oft mit dem Fernglas zumindest erschließen durch "Starhopping". Mit dem Fernglas können wir uns den Zugang zu den Objekten, ihren Positionen am Sternhimmel erarbeiten, auch ohne sie selbst schon zu sehen. Das hilft uns für das spätere Auffinden mit dem Teleskop. Dies ist nebenbei ein Grundmuster der Astronomie: Dass wir von Objekten etwas wissen, ehe wir sie auch wirklich sehen/entdecken.
Und wir gewinnen mit dem Fernglas Beobachtungszeiten. Ein Fernglas braucht keine lange Temperaturanpassung, es ist schnell einsatzbereit, ist flexibel bei den Einsatzorten. Wenn sich in einer sonst günstigen aber bewölkten Nacht mal ein Fenster auftut, kann das Fernglas in kurzer Zeit schöne Seherfahrungen ermöglichen.
Ich habe ein Fernglas immer mit dabei, ein ehrwürdiges und robustes Nikon 8x40 7.5° Sporting II aus den 1990er Jahren, das mit seinem weiten Sehfeld und der ordentlichen Lichtleistung zur Orientierung und zum Auffinden taugt, hellere DSO findet es auch bei leichter Lichtverschmutzung. Wenns mehr Gewicht sein darf, schaue ich mit einem Fujinon 10x50 (extrem brillant) oder einem TS Optics 15x70 (griffiger, lichtstärker). Wenn auch Naturbetrachtung ansteht, nehme ich das DDoptics Pirschler 8x56 mit, das ist handlich, farbtreu und recht brillant. Zuhause mit Aufhängung oder Stativmontierung benutze ich zumeist das TS Optics 20x80 (Stativ) oder das APM 20x110 (Aufhängung).
Exkurs - Einzelne
Ferngläser
Ich stelle hier nicht nur Gläser vor, die ich selber benutze
oder kenne, sondern auch solche, die ich im Kontext dieser
Seite besonders interessant finde - aus unterschiedlichen
Gründen, wegen des Preis-Leistungs-Verhältnisses, wegen der
Eignung für Einsteiger, wegen spezifischer Eigenschaften. Es
geht mir auch darum, einen knappen Überblick zum Angebot für
die astronomische Nutzung zu geben - wobei notgedrungen
manches fehlen muss, Leica und Swarowski etwa wegen des
exklusiven Preisniveaus. Ferngläser haben gegenüber
Teleskopen den Vorteil der einfacheren Handhabung und sie
bieten binokulares, räumliches Zusammenhangs-Sehen. Sie
eignen sich vor allem für die Orientierung und im mobilen
Einsatz. Die 10x70-Gläser sind allerdings nur noch bedingt
geeignet für die freihändige Orientierung. Gläser ab 20x80
erfordern wegen ihrer Vergrößerungsleistung, ihrem Gewicht
und der Länge ein Stativ. Als Faustregel gilt: Über 10facher
Vergrößerung flattert das freihändige Bild, über 1.500 Gramm
Gewicht und 250 mm Länge ist das Glas für längere Zeit
schwer zu halten, unter 80/1000 Gesichtsfeld wird die rasche
Orientierung schwierig. Die genauen Grenzwerte hängen
jeweils von Bauart, Nutzer und Nutzung ab. Ich nehme ein
bestimmtes 1.320-Gramm-Glas noch als leicht wahr, aber eine
anderes, für mich weniger handliches mit 1.460 Gramm bereits
als ausgesprochen schwer!Geordnet sind die Gläser aufsteigend nach ihrer Öffnung, von 50mm bis 100mm. Bei gleicher Öffnung kommt die geringere Vergrößerung zuerst. Geringere Vergrößerung bedeutet größere Austrittspupille (AP) und damit u.U. besseren Lichtempfang im Auge. Da dies aber von individuellen Gegebenheiten (v.a. der persönlichen EP des Auges) abhängt, kann ich das nicht im Vergleich mit der Öffnung werten. Bei einer Entscheidung zwischen 10x50 und 10x70 sollte in jedem Falle geprüft werden, ob man die AP7 von 10x70 überhaupt nutzen kann. 10x70 hat deutlich höheres Gewicht, längere Bauweise, höheren Preis. Die Porro-Prismen der Gläser sind in der Regel in BaK4-Qualität (Barium-Kronglas), Ausnahmen sind Bresser Hunter mit BK7 und Zeiss historisch. Zeiss Conquest und Pirschler verwenden Abbe-König-Dachkant-Prismen, Steiner Observer besonders schlanke Dachkantprismen anderer Bauart.
Manche Puristen sind der Meinung, ein 7x50-Glas sei nur für den Alpenhimmel tauglich, da es unter Siedlungsverhältnissen zu wenig Licht sammle. Ein 70er Glas sammle schließlich etwa doppelt so viel. Das sehe ich - als genießender Amateur - nicht so streng. Faktisch benutze ich zwar freihand vorwiegend mein 15x70er Glas, aber wenn ich mit meinem Fujinon 10x50er vergleiche, kann ich mit dem auch im Siedlungsbereich und vor allem im ländlichen Bereich einiges sehen. Die Lichtsammelleistung (Öffnung zum Quadrat durch EP zum Quadrat) liegt bereits um den Faktor 100 über einem Auge mit 5mm EP. Da Ferngläser im Vergleich mit den meisten Teleskopen (Reflektoren) keine Obstruktion haben, ist die Lichtsammelleistung bei gleicher Öffnung etwas höher. Dazu kommt die größere Austrittspupille durch geringe Vergrößerung als oft vernachlässigter Lichtstärke-Faktor. Was nützt mir eine Öffnung von 80mm, wenn ich bei 20facher Vergrößerung nur eine AP von 4mm habe bei einer EP meines Auges von vielleicht 6mm?
Der Stand für die Preisangaben ist, wo nicht anders angegeben, 2022. Das Angebot ist so umfangreich und differenziert, dass jeder/jede das passende Glas oder die passenden Gläser findet! Gläser mit Winkeleinblick habe ich nicht aufgenommen, Preis und/oder Gewicht führen da sehr schnell in eine andere Liga. Fündig wird man ggf. bei APM Telescopes. Gläser mit Bildstabilisator/Image Stabilization/IS (etwa Canon 15x50 IS) sind teuer und eine AP von 3,33 bei 50mm Öffnung bei Canon bringt für den astronomischen Bedarf sehr wenig Licht. Für den Mondgenuss siehts anders aus, Canon 10x42 L wird dafür gepriesen. Ähnliches gilt für das Zeiss 20x60 S, das gleich mal 7.000 Euro kostet (Stand August 2023). Interessante Besonderheiten sind Sternfeldbeobachter mit Ultra-Weitwinkel wie das Omegon 2x54 für ca. 200 Euro oder Genußgläser wie das Denkmeier Spacewalker 8x42 3D für 300 US-Dollar.
Bresser Hunter 7x50 - Unter 50 Euro kostet dieses bei Tag und bei Nacht gut einsetzbare Porro-Glas mit vollvergüteter Optik und preisgünstiger BK7-Glasqualität (Bor-Kronglas) für die Prismen, Mitteltrieb, Dioptrienausgleich, Gummiarmierung und Stativadapteranschluss. AP 7mm, Gesichtsfeld 122/1000, Nahbereich ab 5 Meter. Länge 190 mm, Gewicht 750 Gramm.
Zeiss 7x50 - Aus alten DDR-Beständen sind bei ebay & Co. Exemplare dieses von der Volkspolizei als "Dienstglas" benutzen Modells mit verschiedenen Bezeichnungen ("Jenoptem", "Binoctem") zu finden, je nach Zustand fallen zwischen 50 und 200 Euro an. Das Modell 10x50 Ost lief unter den Bezeichnungen "Jenoptem" oder "Decarem". Das Modell 10x50 West wurde 1957 bis 1971 produziert, es galt als "Jahrhundertglas". Bei ebay & Co. wird es gelegentlich für etwa 400 Euro angeboten. Alle diese Gläser sind nur aus der Produktion mit vergüteten Linsen noch zu empfehlen.
Nikon Aculon A211 10x50 - Ein Qualitätsglas für etwa 120 Euro. Mehrfachvergütete Linsen, blei- und arsenfreies Eco-Glas BaK4 (Barium-Kronglas), Mitteltrieb, Gummiarmierung, Stativadapteranschluss. AP 5mm, Gesichtsfeld 114/1000, Nahbereich ab 7 Meter. Gewicht 950 Gramm. Es gibt eine Palette weiterer Ausführungen des Modells Aculon zwischen 7x35 und 16x50.
Bresser Astro & Marine 10x50 NP - Günstiges Glas, das Wetterfestigkeit für 240 Euro bietet. Mehrfach vergütete Optik, Einzelfokussierung, Schutzgasfüllung, Gummiarmierung, Stativadapteranschluss. AP 5mm, Gesichtsfeld 114/1000, Nahbereich ab 7 Meter. Länge 191 mm, Gewicht 1.165 Gramm. Stativadapter im Lieferumfang. Für gerade mal 65 Euro ist das weniger leistungsfähige, leichtere Bresser National Geographic 10x50 zu bekommen mit Mitteltrieb.
Fujinon 10x50 FMTR-SX - Marinetauglich nach US-Militär-Standard, herausragend für Naturbeobachtungen und Astronomie, was seinen Preis hat: ab 800 Euro. Fujinon EBC-Vergütung, Field-Flattener-Okulare (randscharf). Einzelfokussierung, Dioptrienausgleich +-5, Schutzgasfüllung, Gummiarmierung, Stativadapteranschluss. Augenmuscheln abschraubbar. Passende UHC-Filter erhältlich (überteuert und nicht für Teleskopokulare verwendbar). AP 5mm, Gesichtsfeld 114/1000, Nahbereich ab 20 Meter. Länge 195 mm, Gewicht 1.460 Gramm. Eher für größere Hände, brillante optische Leistung.
Minox X-Lite 8x56 - Das komfortable, handliche und leichte Dachkant-Glas für Tag und Nacht vom Traditionshersteller kleiner Spezialkameras gibt es für günstige 280 Euro. Kontraststarke Optik, Dachkantprismen. Mitteltrieb, Dioptrienausgleich +-3, drehbare Augenmuschel mit drei Einstellungen, Schutzgasfüllung. AP 7mm, Gesichtsfeld 112/1000, Nahbereich ab 3 Meter. Länge 166 mm, Gewicht 970 Gramm. Die Minox X-Serie bietet auch das leistungsstarke 8x56 HD-Modell mit ED-Gläsern, größerem Sehfeld und 1.250 Gramm Gewicht für 950 Euro.
Steiner Observer 8x56 - Ein schlankes, leistungsfähiges Dachkant-Glas aus Bayreuth für 550 Euro, geeignet bei Nah- und Fernsicht. High-Contrast-Optik, Mitteltrieb mit Fast-Close-Focus, 3stufig verstellbare Augenmuscheln, Dioptrienausgleich +-4, Schutzgasfüllung, Gummiarmierung, Stativadapteranschluss. AP 7mm, Gesichtsfeld 112/1000, Nahbereich ab 2 Meter. Funktionstemperaturbereich -15 bis +55 Grad. Länge 200 mm, Gewicht 1.170 Gramm. Interessant ist auch das etwas klobige, einiges teurere, transmissionsstarke (96%) Porro-Glas Nighthunter 8x56 von Steiner mit Festfokus ab 20 Meter und Gesichtsfeld 135/1000.
DDoptics Pirschler 8x56 gen3 - DDoptics aus Dresden/Chemnitz bietet dieses äußerst handliche, vielseitige, kontraststarke Glas mit ausgezeichneten Eigenschaften für die Astronomie zu 600 Euro. Abbe König Dachkantprismen, ED/Extra Low Dispersion-Glas, Mitteltrieb, Smart Fokus (ab 50 Meter ohne Nachfokussierung), Dioptrienausgleich +-4, Augenmuscheln (unflexibel, mit flachem Rand) in drei Stufen drehbar, Schutzgasfüllung, Gummiarmierung, Stativadapteranschluss. 1,25''-Filter können passgenau aufgelegt werden (Klebeband). AP 7mm, Gesichtsfeld 129/1000, Nahbereich ab 2,5 Meter. Länge 190 mm, Gewicht 1.230 Gramm. Günstiger und leichter (960 Gramm) ist der Pirschler Nachtfalke 8x56 aus Polycarbonat mit etwas bescheidenerer Optik für 300 Euro. Interessant ist auch das EDX 8,5x50 für 1.170 Euro mit auswechselbaren Augenmuscheln (erleichtert den Einsatz von Filtern), es wiegt 870 Gramm.
Zeiss Conquest HD 8x56 - Etwa 1.350 Euro kostet dieses optisch und in der Ausstattung exzellente, schlanke Aluminium-Glas aus Oberkochen, das für Fern- und Nahsicht, hell und dunkel gleichermaßen zu gebrauchen ist. Zeiss T*-vergütete Linsen, Lotu Tec-Beschichtung, Abbe König Dachkantprismen, komfortabler Mitteltrieb (auch mit Handschuhen), Dioptrienausgleich +-4, Augenmuscheln drehbar, Schutzgasfüllung, Gummiarmierung, Stativadapteranschluss. Funktionstemperaturbereich -30 bis +63 Grad. AP 7mm, Gesichtsfeld 125/1000, Nahbereich ab 3,5 Meter. Länge 210 mm, Gewicht 1.265 Gramm.
TS-Optics 10x70 MX ED APO - Ein lichtstarkes Outdoor-Fernglas mit Filteroption unter 400 Euro. Magnesiumgehäuse, sehr ordentliche, mehrfachvergütete Optik, Okulare mit Gewinde für 1,25''-Filter, Einzelfokussierung, Dioptrienausgleich +-5, Schutzgasfüllung, Gummiarmierung, Stativadapteranschluss (zu schwach für die Maße dieses Glases). Erstaunlich gut trotz des Gewichts kurzfristig bzw. mit Stütze/Lehne noch freihändig zu handhaben. AP 7mm, Gesichtsfeld 87/1000, Nahbereich ab 10 Meter. Länge 290 mm, Gewicht 2.400 Gramm. Läuft auch unter dem Firmennamen "APM" oder mit der Modellbezeichnung "Marine".
Fujinon 10x70 FMT-SX2 Eines der tauglichsten Ferngläser für den anspruchsvollen astronomischen Gebrauch. Stoßfest und wasserdicht (MT - Marine Tested), Aluminiumgehäuse. Bildschärfe über das ganze Sehfeld (F - Field Flattener). Fujinon EBC-Vergütung. Einzelfokussierung. Großer Augenabstand, 23mm. Gesichtsfeld 93/1000. Hervorragende, lichtstarke Optik, dennoch ist das Glas gut handhabbar. Länge 280 mm, Gewicht 1.930 Gramm. Wird Stand 2026 nicht mehr hergestellt, gebraucht noch zu bekommen. Preis Anfang 2026 für die Fujinon-Modelle 10x70 neu ab 950 Euro.
Omegon Nightstar 15x70/TS-Optics LE 15x70 - Lichtstark und dennoch leicht, für gerade einmal 130 Euro ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Kann im Winter jedoch innen beschlagen, wie alle nicht schutzgasgefüllten Gläser. Multivergütete Linsen, BaK4-Prismen. Mitteltrieb, Gummiarmierung, Stativadapteranschluss. Griffige Porro-Form, mit Ellbogenstütze/Anlehnen noch gut freihändig zu nutzen. AP 4,7mm. Gesichtsfeld 77/1000, Nahbereich ab 10 Meter. Länge 270 mm, Gewicht 1.320 Gramm (ohne Gurt und Abdeckungen). Innen beschlagfrei bleibt im Winter das Bresser Spezial-Astro 15x70 SF für 315 Euro mit 1.900 Gramm Gewicht. Kollimation bei allen dreien meiner TS-Optics-Exemplare vom 15x70er war schlecht, Nachjustieren einfach.
Bresser Spezial-Astro 20x80 - Mit BaK4-Prismen zu einem sehr günstigen Preis von ca. 160 Euro. Mitteltrieb, integrierter, verschiebbarer Stativanschluss. AP 4mm, Gesichtsfeld 56/1000, Nahbereich ab 40 Meter. Länge 330 mm, Gewicht 2.100 Gramm. Höheren Ansprüchen an Optik und Verarbeitung genügt das 600 Gramm schwerere, wetterfeste Modell SF-ED für dann ca. 840 Euro. Es existieren weitere Varianten des Spezial-Astro und bauähnliche Gläser von Omegon und TS-Optics, auch mit Triplet-Objektiven. Sehr gelobt wird auch das Opticron Oregon Observation 20x80. Leichte Farbsäume beim TS-Optics Triplett, Kollimation an meinem Exemplar war schlecht, Nachjustieren einfach.
APM MS 20x100 - Ein leistungsstarkes, wertig gearbeitetes Großfernglas für die Astronomie zu einem soliden Preis von 850 Euro. Die Lichtsammelleistung liegt um 56% über einem Modell 20x80. Magnesiumgehäuse, FMC-Vergütung, BaK4-Prismenglas, Einzelfokussierung, Dioptrienausgleich +- 8! Schutzgasfüllung, Gummiarmierung, mittige Stange mit abnehmbarem, verschiebbarem Stativanschluss. AP 5mm, Gesichtsfeld 58/1000, Nahbereich ab 40 Meter. Länge 380 mm, Gewicht 3.850 Gramm. Mit ED-Glas 400 Gramm schwerer, für dann 1.200 Euro. Es gibt weitere interessante APM-MS-Modelle. APM liefert auch bewährte Gläser mit Winkeleinblick - die sind allerdings teurer, schwerer, länger.
Das Maximum an Lichtleistung bei einem Fernglas mit Geradeblick bieten Stand März 2023 Gläser mit den Werten 20x110 - mal abgesehen von den exzellenten, aber hochpreisigen und schwierig zu handhabenden Fujinon-Gläsern 25x150 bzw. 40x150. Allerdings liegen die Ausmaße (Gewicht und Länge) bereits in der Kategorie von 6''-Teleskop-Tuben, weshalb die Anschaffung wohl erwogen werden sollte. Die Lichtleistung ist 21% höher als bei 20x100, für Menschen mit einer Eintrittspupille des Auges über 5mm im Effekt noch etwas darüber. Die Länge beträgt bei der ED-Variante von APM stolze 520 Millimeter, das Gewicht 5.600 Gramm, der Preis ca. 1.500 Euro (Stand Mai 2023). Kollimation an meinem Exemplar war schlecht!
3.2 Stativ und Montierung
Für die Himmelsbeobachtung mit dem Fernglas ist eine
Armstütze oder ein Stativ zu empfehlen bei Vergrößerungen
über 10fach. Sonst kommt es zu Wackelbildern, Flackern. Je
näher ein Objekt ist und je höher die Vergrößerung, umso
lästiger das Flackern. Daher sind Saturn und Jupiter nicht
die idealen Fernglasobjekte ohne Stativ. Die meisten
heutigen Qualitätsferngläser haben ein Gewinde an der
Brücke, an dem ein Stativadapter befestigt werden kann, so
dass jedes Fotostativ einsetzbar ist. Besonders sinnvoll ist
die Mittelschiene bei großen Gläsern mit variabler
Positionierung des Stativadapters. Für andere Ferngläser
gibt es brauchbare Halterungen, etwa von Gosky, die mit
elastischen Bändern das Fernglas auf einer Platte
festklemmen, die ihrerseits auf Stative aufgeschraubt werden
kann.Von Stativen zu Ferngläsern sollten allerdings keine Wunder erwartet werden! Die bringen zwar ruhige Bilder, aber im astronomischen Bereich auch Einblickprobleme, sobald wir die Horizontnähe verlassen. Es sei denn, wir verwenden Winkelokulare. Und ein Stativ bringt nur dann ruhigere Bilder, wenn wir Stativ und Fernglas nicht berühren - was schwierig ist, da wir den besten Blick durchs Glas in der Regel dann haben, wenn die Augen an den Muscheln anliegen. Was Stative mit dem Fernglas in der Astronomie auch mit hoher Sicherheit bringen sind
 :
Nackenschmerzen.
:
Nackenschmerzen.Für meine kleineren Gläser (Nikon 8x40, DDoptics 8x56, Fujinon 10x50) benutze ich in der Regel kein Stativ. Hier genieße ich die freihändige Führung - natürlich bei Bedarf und Möglichkeit mit Sitzgelegenheit, Nackenstütze, Ellbogenstütze. Ein Bodensitz, ein Campingstuhl mit Armstützen und verstellbarer Rückenlehne oder eine Matte sind außerordentlich nützlich und oft wertvoller (und rückenschonender) bei der Fernglasnutzung als ein Stativ!
Bei schweren Gläsern oder Spektiven greife ich gelegentlich zu einem schwingungsarmen Stativ mit der schlichten azimutalen Fernglasmontierung von TS Optics mit Prismenklemme plus Prismenschiene und Gegengewicht - siehe Abbildung rechts mit TS Optics 20x80. Die taugt auch für leichtere Teleskoptuben. Allerdings ist sie nicht sonderlich gut in einer Position zu fixieren ohne dabei wieder die Position zu verlieren. Besser fixierbar und steuerbar ist ein Fluid-Neiger. Neiger packen allerdings nicht so viel Gewicht. 2 Wege reichen für den astronomischen Bedarf. Wer einen 3-Wege-Neiger schon für Foto/Video hat, kann damit natürlich auch arbeiten - ich verwende den MHXPRO-3W von Manfrotto (Friction). Zu beachten ist allerdings, dass Neiger für die Fotografie oft nicht wesentlich über Horizontniveau zu heben sind im regulären Gebrauch, für die Astronomie müssen sie gedreht werden. Für schwere Gläser kann auch eine Gabelmontierung in Frage kommen, etwa von Omegon oder APM.
Die tragfähigen, flexiblen und bildstabilen Parallelogramm-Montierungen mit Gegengewicht sind kostspielig und nicht für jeden befriedigend. Es gibt von Omegon die Pro Kolossus, von Farpoint die UBM (günstiger direkt aus den USA) oder von Bresser die Slider-Montierung für etwa 800 Euro. Wer es besonders komfortabel möchte, kann sich für 3.500 Euro (alle Preisangaben Stand 2022/23) die 10Micron Montierung von Leonardo anschaffen. Der Eigenbau ist billiger und durchaus machbar. Dazu gibt es auf Foren zahlreiche Modelle und Bastelanleitungen. Ein Nachteil der Parallelogramm-Montierungen ist ihre raumgreifende Sperrigkeit.
Grundsätzlich können auch Teleskopmontierungen - mit einem kleinen Anbau - Ferngläser aufnehmen. Allerdings empfehlen sich nur azimutale Montierungen, bei parallaktischen müsste man sich gelegentlich den Hals sehr verrenken bei der Beobachtung. Besonders nützlich sind Teleskop-Montierungen, wenn eine GoTo-Steuerung integriert ist. Dann können wir auch mit dem Fernglas automatisch ein Objekt nachverfolgen oder neue Objekte aufsuchen. Allerdings: Ohne Winkeleinblick gibt es bei größeren Zielhöhen Nackenprobleme, vor allem bei kurzem Stativ!
 Zu
beachten ist dabei:
Zu
beachten ist dabei:1. Das Tragevermögen der Montierung darf nicht überschritten werden. Es empfiehlt sich, vor allem bei einseitiger Belastung, das Tragevermögen maximal zu etwa 2/3 auszunutzen. Da die Schwerpunkte beim Fernglas anders als beim Tubus liegen, kann es sonst zu Schäden an der Montierungssteuerung kommen.
2. Das Fernglas sollte etwa auf der Höhe der Schwalbenschwanz/Prismenschienen-Aufnahme der Montierung angebracht sein, um Hebelwirkungen zu reduzieren (die bei lichtstarken Porrogläsern der Breite wegen schon zwangsläufig auftreten). Es kann sonst passieren, dass die Montierung sich spontan bewegt mit dem Gewicht des Fernglases.
Erfolgreich ausprobiert habe ich es mit dem 15x70-Glas von TS-Optics auf einer Celestron NexStar-Montierung. Aber Achtung: Sobald es Richtung Zenit geht, wird der Einblick schwierig, da das Stativ zur NexStar sehr kurz ist und man ohne Winkeleinblick dann auf den Boden hocken oder knien muss, um noch durchs Glas schauen zu können. Für mein größtes Fernglas, das 20x110 von APM, habe ich mir die Skywatcher GTiX-Reisemontierung zugelegt (s. unten). Diese Montierung lässt sich auch in beiden Achsen frei bewegen, ohne dass die Positionierung verloren geht! Leider klemmt das Teil bei freier Bewegung azimutal ab 4 Kilogramm einseitiger Zuladung. Gesteuert wird mit der sehr brauchbaren SynScan-App. Mit dieser Kombination, Fernglas, GTiX und SynScan, bin ich insgesamt zufrieden. Auch wenn sie mir nicht die Freiheit gibt, die ich mit der Fernglasaufhängung habe, die im folgenden Exkurs beschrieben wird.
Eine erste - starre - Stativmontierung mit Gegengewicht für das Fernglas hat die Firma Zeiss in den 30er Jahren entwickelt (siehe Foto links).
Exkurs:
Fernglasaufhängung
Wer regelmäßig auf einer  Loggia oder unter einem Vordach
beobachtet, der hat vielleicht die Möglichkeit, eine
besonders günstige und praktische Haltevariante für
gewichtige Ferngläser auszuprobieren: An einem Balken über
meiner Loggia habe ich mit 2 Ösen, 2 Umlenkrollen,
Gegengewicht und Seil eine optimal bewegliche Aufhängung
gestalten. Als (variables) Gegengewicht benutze ich einen
Camping-Trinkwasserbeutel. Siehe Abbildung links mit TS
Optics 20x80 Triplet (Gewicht 2,4 kg). Diese
Hänge-Lösung bringt zwar kein ganz ruhiges Bild (Jupiter und
Saturn sollte man damit nicht betrachten), entlastet aber
die Arme und den Rücken vom Gewicht des Fernglases, ist
enorm flexibel und erspart bei halb liegendem Sitz die
Nackenknickungen beim Blick durch das Fernglas, die am
Stativ fast immer auftreten!
Loggia oder unter einem Vordach
beobachtet, der hat vielleicht die Möglichkeit, eine
besonders günstige und praktische Haltevariante für
gewichtige Ferngläser auszuprobieren: An einem Balken über
meiner Loggia habe ich mit 2 Ösen, 2 Umlenkrollen,
Gegengewicht und Seil eine optimal bewegliche Aufhängung
gestalten. Als (variables) Gegengewicht benutze ich einen
Camping-Trinkwasserbeutel. Siehe Abbildung links mit TS
Optics 20x80 Triplet (Gewicht 2,4 kg). Diese
Hänge-Lösung bringt zwar kein ganz ruhiges Bild (Jupiter und
Saturn sollte man damit nicht betrachten), entlastet aber
die Arme und den Rücken vom Gewicht des Fernglases, ist
enorm flexibel und erspart bei halb liegendem Sitz die
Nackenknickungen beim Blick durch das Fernglas, die am
Stativ fast immer auftreten!Da ich mit der Hängelösung sehr gute Erfahrungen gesammelt habe, bin ich einen Schritt weiter gegangen und habe mir eine freistehende Ausrüstung gebaut, die ich überwiegend auf einem eigenen Wiesengrundstück außerhalb des Siedlungsbereiches verwende. Mit Einschränkung ist diese Aufhängung auch mobil. Der 2 Meter lange Tragepfosten von 70x70 Millimeter Querschnitt braucht allerdings ein geeignetes Transportgefährt. Mit dem Fahrradanhänger ist das nicht zu machen.
Benötigt werden aus dem Baumarkt: 2 Kanthölzer 70x70mm, Länge 2000 mm; 1 Bodenhülse 71x71; 1 Pfostenverbinder T-Stück; 2 Hakenösen; 2 Umlenkrollen; 2 Karabinerhaken; 1 Seil; 1 Gegengewicht. Die meisten Teile habe ich bei Hornbach gefunden, den Pfostenverbinder
 musste
ich über das Internet besorgen. Kosten insgesamt: ca. 70
Euro. Werkzeuge: Vorschlaghammer, Wasserwaage, eventuell
Bohrmaschine zum Vorbohren der Löcher für die Hakenösen.
musste
ich über das Internet besorgen. Kosten insgesamt: ca. 70
Euro. Werkzeuge: Vorschlaghammer, Wasserwaage, eventuell
Bohrmaschine zum Vorbohren der Löcher für die Hakenösen.Von den Kanthölzern wird eines in voller Länge für den Tragepfosten benötigt. Das zweite kann gekürzt werden auf 1.50 Meter. Der Schnittrest dient zum Einschlagen der Bodenhülse. Eine Einschlaghülse funktioniert nur bei wenig steinigem, ausreichend verdichtetem oder durchwurzeltem Boden. Alternativ kann eine Hülse einbetoniert werden - was etwas mehr Aufwand erfordert.
Der kürzere Balken wird als Querbalken in den längeren Teil des Pfostenverbinders eingeführt. Dazu wird u.U. der Vorschlaghammer benötigt. Das Holz kann mit Kerzenwachs (einfach damit einreiben, ein Teelicht genügt) gleitfähig gemacht werden. Eventuell ist es auch notwendig, den Pfostenverbinder innen mit einer Metallfeile zu glätten. Mit dem kürzeren Teil des Pfostenverbinders wird der Querbalken auf den Tragepfosten abnehmbar montiert. Natürlich kann der auch fest verschraubt werden, aber es empfiehlt sich, die Vorrichtung zumindest über Winter abzunehmen und einzulagern, um Verwitterung und Rost zu reduzieren. Alternativ kann der Querbalken auch ohne einen T-Pfostenverbinder fest montiert werden, falls kein Wert auf flexiblen Auf- und Abbau gelegt wird.
An den beiden Enden des Querbalkens werden die Hakenösen montiert und daran die Umlenkrollen für das Seil gehängt. Die Karabinerhaken dienen zum Anhängen des Fernglases und des Gegengewichts am Seil. Als Gegengewicht verwende ich wie zuhause einen Wasserbeutel. Das Konstrukt trägt ohne Probleme auch ein 20x110er Glas. Siehe Abbildung rechts mit den Sitz-/Liegealternativen Luftsofa und Bodenstuhl.
Ohne Balken kann auch ein Hängesessel-Ständer mit einer kleinen Erweiterung aus meinem Kamerahalter-Bestand die Umlenkrollen tragen. Eine rucksack-mobile Fernglasaufhängung nach dem gleichen Bauprinzip habe ich mir mit Stativ (Triton FGX3 - 160 Euro), Fotogalgen (Walimex Pro - 80 Euro), zwei Spigot Stativadaptern, vier Karabinerhaken, zwei Umlenkrollen und einem Seilstück von drei Metern gebastelt. Der mute ich aber maximal ein 20x80 Glas plus Gegengewicht zu.
Bei den Sitz-/Liegegelegenheiten auf dem Foto rechts handelt es sich um eine Wanderfalke Luftliege ("Luftsofa") und einen Bonvivo Bodenstuhl Easy II.
3.3 Fernglaszubehör
Filter
Es gibt nur wenige Gläser mit Filtergewinde (etwa TS
Optics 10x70 MX). Ich behelfe mir bei anderen Gläsern mit
Einlegeringen T2/M42 auf 1,25'' oder 38mm auf 1,25'' von Gerd Neumann.
Die 42er kann ich beim TS 20x80 perfekt in die
Augenmuscheln einklemmen und dort belassen, beim APM
20x110 brauche ich noch einen Fixierring 44mm aus der
Sanitärabteilung. Beim TS 15x70 nehme ich die 38er und
Sanitär-Klemmdichtungen oder die 42er alleine (klemmt
etwas). Beim Fujinon 10x50 nehme ich die 42er, die aber
dort zu viel Spiel haben, weshalb ich mit zwei flachen
Dichtungsringen 44mm stabilisiere. Ich komme gut klar mit
den Schläfer Dichtungsringen 1 1/2 Zoll (44 zu 33
mm). Die "leeren" Einlegeringe können bei hellen Objekten
wie dem Jupiter allerdings je nach Augenstellung Reflexe
bringen!
An Gläsern mit Öffnungen bis 45mm kann für den Einsatz
bei sehr dunkel-klarem Himmel auch der Einsatz von
2''-Filtern am Objektiv erwogen werden, wenn die eigene
Investitionsbereitschaft das hergibt oder die Filter
ohnedies da sind vom Teleskop.
Grundsätzlich können bei der Nebel-Schau die gleichen
Filtertypen verwendet werden wie für das Teleskop. Zu
empfehlen sind vor allem Filter, die wenig Licht
schlucken. Also zunächst einmal UHC-Filter. Aber auch
OIII-Filter können je nach Glasstärke und Sehbedingungen
funktionieren. Bei der Anschaffung bedenken, dass für das
Fernglas immer ein Paar benötigt wird, das kann schnell
ins Geld gehen - möglichst abstimmen mit den Filtern für
das Teleskop. Und nicht vorschnell zukaufen, wenn es
Frustrationen gibt, Filter fordern Geduld und Erfahrung!
Verschiedene Filter für Rechts und Links zu verwenden,
kann besonders für direkte Vergleiche gelegentlich zum
Ausprobieren sinnvoll sein, bringt aber eher
unbefriedigende Seherfahrungen. Hilfreich ist es auch, in
der Lernphase gelegentlich nur auf einem Okular einen
Filter aufzusetzen - für den Dauergebrauch ist das höchst
unbefriedigend. Näheres zu den verschiedenen Filtern siehe
unter 3.9.
Probleme bringt der Einsatz von Filtern am Fernglas beim
Aufsuchen der Objekte. Denn durch das Wegfiltern
schwächerer Sterne wird das Starhopping erschwert. Bei
Ferngläsern gilt zudem noch mehr als bei Teleskopen: keine
Wunder von Filtern erwarten! Am Besten als Anfänger
erstmal die Finger von Filtern lassen, sie bringen oft
Frustationen, die dann Geld für neue Versuche
verschlingen. Und die meisten Ferngläser können Filter eh
nicht aufnehmen ohne Bastelei.
Ein Mondfilter kann allerdings auch für Anfänger schon
sinnvoll sein und ein Sonnenfilter ist unabdingbar bei
entsprechendem Interesse.
Sucher
Bei Winkeleinblickern, die immer auf einem Stativ zu
montieren sind, ist ein Sucher sicherlich sinnvoll. Bei
konventionellen Ferngläsern mit geradem Einblick bringt er
unnötige Komplikationen. Es genügt in der Regel die
Peilung, verbunden mit Starhopping. Mit Filtern
(Abdunkelung) und hoher Vergrößerung (kleines
Gesichtsfeld, Abdunkelung) wird das Starhopping
schwieriger. Bei der Peilung muss man lernen, mit den
jeweiligen Besonderheiten eines Fernglases umzugehen. Mit
dem Fujinon 10x50 klappt es bei mir am Besten, das ist so
gebaut, dass die Peilung am Korpus stimmt. Bei allen
anderen Gläsern muss ich nach oben korrigieren. Ein
seitlicher Blick auf den Bau eines Fernglases erklärt in
der Regel, warum das so ist. Am 20x80-Glas montiere ich
gelegentlich bei Filtereinsatz mit Klemme einen leichten
6x30-Sucher. Dann brauchts natürlich ein Stativ! Und wenn
ich ein Fernglas auf eine GoTo-Montierung setze, ist ein
Sucher für das Alignment sehr hilfreich. Er kann bei der
GTiX-Montierung auf der Seite des Gegengewichts angebracht
werden.
Abdunkelung
Ferngläser benutze ich häufig in Gebieten mit Streulicht,
das seitlich in die Augen fällt. Es ist zunächst wichtig,
durch die Wahl des Standortes den Einfall möglichst zu
reduzieren. Was an Licht bleibt, lässt sich abschirmen
z.B. mit dem "Slicker Bino Bandit", der ist ähnlich einer
Taucherbrillenfassung gebaut, aus Neoprenstoff, und wird
am Fernglas befestigt, nicht am Kopf. Man bleibt also
flexibel. Allerdings sind die beiden Öffnungen sehr eng
und katzenaugenartig geschnitten und daher fummelig
anzubringen bei größeren Gläsern/Gläsern mit weiten
Okularen wie etwa dem Fujinon. Beim 20x110 gehts gar nicht
mehr. Bei dem verwende ich eine Mittelalterkapuze, einen
sogenannten "Gugel" (verwandt mit der Backware Gugelhupf).
Und zwar das Modell "Schurke" (nicht "Mönch"!) von
Blessume in Schwarz. Stabil und lichtdicht.
Auch für das Teleskop verwendbar ist die kleine
"Dunkelkammer", die ich mir aus einem ausrangierten
Tilley-Hut (stabile Krempe) mit schwarzem Samtstoff
gebastelt habe. Leider kann es damit am Teleskop Konflikte
mit dem Sucher geben. Nicht gleich festnähen, sondern erst
mal den Stoff mit Büroklammern befestigen und
ausprobieren! Oft verwende ich einfach nur ein schwarzes
Samttuch von einem Quadratmeter, das ich über den
Okularbereich von Teleskop/Fernglas und Kopf ziehe.
Schnell und praktisch!
Unter Abdunkelungshüllen steigt die Gefahr des
Beschlagens der Okulare von außen, vor allem bei
Geradblick nach oben, zur Zenitnähe - wegen der
aufsteigenden wärmeren und feuchteren Körperluft.
Sitzgelegenheit
Nicht mehr missen möchte ich im Freien meinen Bodenstuhl
Easy II von Bonvivo mit einer in vier verschiedenen
Positionen arretierbaren Rückenlehne - vor allem für
zenitnahe Beobachtungen. Andere schwören für zenitnahe
Beobachtungen auf Kinderschlauchboote. Ich habe gute
Erfahrungen mit einem Wanderfalke Luftsofa gemacht, das im
Kopf-/Schulterbereich besonders breit geschnitten ist und
dessen Wulste gute Ellbogenstützen abgeben. Hilfreich sind
diese beiden Sitz-/Liegegelegenheiten vor allem dann, wenn
ein Campingstuhl oder ein Hocker zu sperrig für den
Transport sind (etwa mit der Bahn oder mit dem Fahrrad).
Mit der Fernglasaufhängung verwende ich meist einen
Garten-/Campingstuhl mit verstellbarer Rückenlehne und
Armstützen. Bewährt haben sich Modelle von Brunner und
Crespo. Unterwegs mit leichtem Gepäck muss das Luftsofa
herhalten oder einfach eine Decke plus aufblasbares
Keilkissen oder eine Isomatte. Am Stativ (auch mit
Teleskop) nutze ich einen höhenverstellbaren Barhocker.
Ein drehbarer Klavierhocker oder ein anderer Drehstuhl tun
es auch. Aber aufpassen, das kann wackelig werden.
Besonders geeignet sind Klavier-/Barhocker mit
Gasdruckfeder - diese erspart das ständige Rauf- und
Runterdrehen. Dobsonauten setzen gerne Stehleitern ein,
auf denen man auch irgendwie sitzen kann.
Stativadapter
Im Handel sind schlichte Stativadapter für die Verbindung
von Stativ und Fernglas über eine Gewinde am Fernglassteg
zu bekommen. Als ich mich gezielter mit Ferngläsern für
die Astronomie beschäftigte, dachte ich noch, ein
Adaptergewinde am Steg sei ein Qualitätsmerkmal. Dieser
Meinung bin ich nicht mehr, es gibt äußerst qualitätsvolle
Gläser wie das Leica Geovid 15x56, die darauf verzichten.
Und dafür gibt es gute Gründe. Die Verbindung zwischen
Adapter und Fernglas ist kaum so stabil hin zu bekommen,
dass das Fernglas sich nicht um diese Stelle drehen kann.
Daher bietet z.B. Leica eine ganz andere Art der
Verbindung an, die nicht sehr elegant wirkt, aber äußerst
funktional ist: Eine Platte mit Haltebändern für das
Fernglas, die auf das Stativ geschraubt wird. Und das
funktioniert. Mit einer Holzplatte gibt es das in eher
schlichter Ausführung bei Berlebach auch für andere
Gläser. Ich habe bei Amazon ein Angebot gefunden, das mich
sehr überzeugt, die Universal-Fernglas-Stativhalterung von
Solomark. Größere Gläser ab 80mm haben in der Regel eine
integrierte, verschiebbare Stativhalterung.
3.4 Spektiv
Beim Spektiv ist die Anschaffung für die Astronomie alleine selten sinnvoll wegen des höheren Preises gegenüber Ferngläsern und der kleinen Austrittspupille=wenig Licht (ergibt sich aus der Formel Öffnung:Vergrößerung). Dann lieber gleich ein Teleskop, falls es nicht darum geht, mit möglichst geringem Ausrüstungsaufwand unterwegs zu sein. Ein Spektiv ist auch zur Naturbeobachtung sehr gut zu gebrauchen und vielleicht ohnedies schon vorhanden.Für den Blick zum Himmel ist ein Spektiv mit Winkeleinblick/Schrägeinblick vorteilhaft, da sich sonst ähnliche Probleme wie beim Fernglas für Rücken und Nacken ergeben. Ein Stativ, vorzugsweise mit azimutaler Fernglas-/Spektivmontierung, oder ein entsprechender Ersatz wie eine stabile Klammerhalterung am Balkongeländer mit Kugelkopf ist für das Spektiv unabdingbar. Die hohen Vergrößerungen und die Länge der Instrumente führen unweigerlich zu lästigen Vibrationen. Außerdem sind Spektive sehr gewichtig. Ein Spektiv kann, wie auch ein Fernglas, häufig innerorts eingesetzt werden, da die relativ geringe maximale Vergrößerung und die noch immer eher bescheidene (gemessen an astronomischen Ansprüchen) Öffnung toleranter machen gegen Streulicht und atmosphärische Störungen. Eine Öffnung von 80mm und ein Zoom-Okular 20-60 (eventuell auch 65mm und 15-45) reichen völlig aus für genußvolle Betrachtungen von Mond und lichtstarken Planeten. Allerdings sollte man sich darüber im Klaren sein, dass von der 80mm-Öffnung nicht viel im Auge ankommt bei einer 60-fachen Vergrößerung! Die Austrittspupille wird sehr klein, was rasch zu Frustrationen bei lichtärmeren Objekten führen kann.
Das Angebot an ordentlichen Spektiven zu einem Preis unter 500 Euro (es muss ja nicht unbedingt ein Zeiss sein) ist überwältigend. Bei der Auswahl sollte auf Folgendes geachtet werden: Leicht gängiges Zoom-Okular, gut zugängliche und leichtgängige Fokussierung. Optimal ist ein Gerät mit Feinfokussierung. Im Zweifelsfall besser die gute Fokussierung als die größere Öffnung wählen. Oder 200 Euro drauflegen. Denn nichts ist nervender am Spektiv als das endlose Nachzittern beim Zoomen und Scharfstellen! Wichtig ist zur Reduzierung der Schwingungen auch, dass die Stativbefestigung etwa im Schwerpunkt des Spektivs liegt.
Hilfreich ist - abhängig vom Einsatzzweck und der sonstigen Ausrüstung - die Möglichkeit, das Okular wechseln zu können. Leider haben Spektive in der Regel keinen Sucher, eine der wenigen Ausnahmen ist Celestron mit einem kleinen Peilrohr an der Seite. Spektive werden eben in der Regel zur Tagbeobachtung und für größere Objekte als bloße Lichtpunkte am Himmel benutzt. Für das Sternegucken ist ein Sucher am Spektiv aber durchaus hilfreich. Denn die Ausrichtung eines Spektivs bei Nacht ist weit schwieriger als die eines Fernglases, zumal bei Winkeleinblick! Ich habe mir mit einem aufgeklebten Punktsucher geholfen. Das ständige Nachjustieren des Plastik-Wackelteils nervt allerdings. Ein TS oder Omegon 6x30 Sucher mit Geradblick ist besser geeignet, aber schwerer. Dieser Sucher hat auch den Vorteil, dass er bei leichter Sehschwäche ohne Brille gut nutzbar ist, da er fokussiert werden kann.
Primäre Objekte für das Spektiv sind Mond und Planeten. Eine Öffnung bis 80mm erlaubt auch noch die detailscharfe Mondbetrachtung ohne Mondfilter. Wer keine Astrofotografie betreibt, der ist für die Mondbetrachtung mit einem Spektiv bereits gut ausgerüstet! Für die Planeten wird man gelegentlich sich eine höhere Vergrößerung wünschen, doch mit 60-fach ist schon viel zu sehen!
Auch die Plejaden, der Orion-Nebel und etliche andere interessante und einfache Deep-Sky-Objekte sind genussvoll zu betrachten. Ein nettes Spektiv-Objekt ist z.B. der Doppelstern Mizar-Alcor im Sternbild des Großen Bären, der mittlere Deichselstern (am Knick). Die beiden waren schon in der mittelalterlichen arabischen Astronomie bekannt. Wer die beiden optisch auflösen konnte, habe gute Augen, so hieß es. Eine berührende Erfahrung ist es, zu sehen, wie Alkor von Mizar immer weiter abrückt beim Zoomen! Mit höheren Vergrößerungen löst sich Mizar dann noch auf in Mizar A und B.
3.5 Teleskop
Die inhaltlich relevanten allgemeinen Fakten habe ich
bereits oben unter den "Grundentscheidung" (2.1 bis 2.5)
angeführt.
Vor der Entscheidung für das erste Teleskop ist es
sinnvoll, einmal bei Freunden, bei einem Astrotreff oder
in einem gut sortierten Laden die Breite des Sortiments
kennenzulernen. Unbedingt Zeit lassen und realistisch
abschätzen, was man mit dem Gerät in nächster Zeit tun
möchte und tun kann - auch im Blick auf den zeitlichen
Aufwand. Auf keinen Fall von hohen Vergrößerungen und
Sonder-/Sparangeboten blenden lassen. Über einen günstigen
Preis freut man sich nur einmal, beim Einkauf. Über gute
Qualität freut man sich immer, bei jeder Benutzung.
Skeptisch bleiben gegenüber vollmundigen
GoTo-Versprechungen zu "erlebnisreichen
Himmelsspaziergängen".
Ob man mit einem guten parallaktisch montierten
Linsensteleskop auf Galileis oder Fraunhofers Spuren oder
mit einem azimutal montierten "Newton" beginnen möchte,
ist auch eine Frage des persönlichen Stils. Da darf auch
"das Herz" mitentscheiden. Newtons Reflektor von 1668
nimmt bereits das Selbstgebastelte der Dobsons vorweg,
anrührend (aber auch schon vorbildlich) sind der
kartonagehafte Tubus, die handgedrechselte hölzerne
Kugelkopfmontierung und der schlichte Einblick oben
(charakteristisch für Newtons). Das Exemplar der Royal
Society London (s. Abbildung rechts) wurde 1766 von einem
Antiquar übereignet, ob es wirklich auf Newton zurückgeht,
ist fraglich. Fraunhofers 245mm Linsenteleskop von 1820/26
bewahrt trotz seiner gewaltigen Ausmaße noch etwas vom
eleganten Charme der "Fernrohre" früher Jahre. Das
Berliner Exemplar von 1820 steht im Deutschen Museum
München (s. Abbildung links), das zweite Exemplar steht
seit 1826 in der Sternwarte Dorpat/Tartu tähetorn in
Tartu, Estland.
 Gerne wird mit der
"Ausbaufähigkeit" von Teleskopausrüstungen geworben.
Jeder, jede muss sich aber überlegen, ob es sinnvoll ist,
Geld in eine schon einiges teurere "aufrüstbare"
Ausrüstung zu investieren, deren einzelne Zusatzgeräten
dann weiteres Geld kosten, oder nicht lieber gleich eine
Ausrüstung anzuschaffen, die schon möglichst viel
integriert hat, vor allem Autoalign, GoTo, Nachverfolgung.
Stromversorgung und Fokusmotor bleiben häufig weiterhin
Zusatzgeräte.
Gerne wird mit der
"Ausbaufähigkeit" von Teleskopausrüstungen geworben.
Jeder, jede muss sich aber überlegen, ob es sinnvoll ist,
Geld in eine schon einiges teurere "aufrüstbare"
Ausrüstung zu investieren, deren einzelne Zusatzgeräten
dann weiteres Geld kosten, oder nicht lieber gleich eine
Ausrüstung anzuschaffen, die schon möglichst viel
integriert hat, vor allem Autoalign, GoTo, Nachverfolgung.
Stromversorgung und Fokusmotor bleiben häufig weiterhin
Zusatzgeräte.
Ich persönlich plädiere dafür, erst mit einer günstigen
manuellen Ausrüstung ohne GoTo zu beginnen und dann nach
einiger Übungs- und Erfahrungszeit bei anhaltendem
Interesse richtig zu investieren - und dazwischen zu
sparen auf die elektronisch gestützte Ausrüstung. Die
erste Ausrüstung kann dann immer noch nützlich sein, wenns
mal ohne Strom gehen soll und mit weniger Gepäck.
Irgendwann haben viele Hobby-Astronomen mindestens drei Ausrüstungen. Etwa so: Ein kleineres Linsenteleskop, manuell, schlicht, parallaktisch, für unkomplizierte kontrastreiche Beobachtungen, gern auch mal ohne Polausrichtung. Eine 150er azimutal mit guter elektronischer Unterstützung für ausgedehnte Himmelsspaziergänge am Händchen der Technik. Und dann, wenn die Kugelhaufen, Nebel und Galaxien immer lauter rufen, ein 200mm Newton parallaktisch oder ein Leichtbau-Dobson mit 250mm Öffnung (bei Öffnungen darüber den Orthopäden fragen, schon mal ins Fitness-Studio gehen oder eine Sternwarte bauen). Oder auch ganz anders - der Himmel ist groß, die Teleskopwelt auch.
Lektüreempfehlung: Henry C. King, The History of the
Telescope, High Wicombe: Charles Griffin & Co., 1955
Exkurs -
Einzelne Teleskope
Ich stelle hier nicht nur Geräte vor, die ich selber benutze
oder kenne, sondern auch solche, die ich besonders
interessant finde - aus unterschiedlichen Gründen, wegen des
Preis-Leistungs-Verhältnisses, wegen der Eignung für
Einsteiger, wegen spezifischer Eigenschaften. Es geht mir
auch darum, einen knappen Überblick zum Angebot zu geben,
von 90mm bis 500mm Öffnung. Anfängertauglichkeit ist dabei
nicht immer gegeben. Die allgemein akzeptierte Schwelle für
anspruchsvolle Galaxien- und Nebelstrukturen-Auflösung liegt
bei 200mm Öffnung. Für Einsteiger/Neukäufer gebe ich die
Empfehlung, nicht im Winter oder im Sommer zu kaufen, um
unnötige Frustrationen zu vermeiden. Im Winter macht die
Einarbeitung bei Frosttemperaturen wenig Freude, im Sommer
ist das Seeing durch langes Sonnenrestlicht häufig schlecht.
Die Preise können dann allerdings u.U. günstiger sein.Der Stand für die Preisangaben ist - wo nicht anders angegeben - Anfang 2022, bei TS-Optics, Teleskop-Spezialisten, Noctutec, Astroshop, Bresser, Spacewalk, Unistellar. Die Gewichtsangaben der Lieferanten sind teilweise ungenau/widersprüchlich.
Bresser AC 90/900 Messier Nano AZ - Für ca. 250 Euro gibt es von Bresser ein kontrastreiches achromatisches Linsenteleskop für unkomplizierte Beobachtungen unter guten Bedingungen. Vor allem für Planeten und Mond, mit Sonnenfilter auch für die Sonne. Hellere/nahe Nebel und Galaxien sind auch schon erreichbar. Zenitspiegel, ein Okular 26mm. Taugliches 6x30 Sucherfernrohr, schlichte, aber ordentliche azimutale Montierung. Mit der bescheidenen EQ3 kostet er 300 Euro. Ist auch ohne Montierung und Stativ zu bekommen unter 200 Euro. Von Skywatcher gibt es zu einem ähnlichen Preis das Evostar 90/900.
Skywatcher Evostar APO 100/900 ED - Wer bereit ist, tiefer in die Tasche zu greifen, kann diesen anspruchsvollen apochromatischen Refraktor für 1.200 Euro (Stand September 2023) ohne Stativ/Montierung in den Blick nehmen. Das Öffnungsverhältnis von 1:9 ist eher für Planeten geeignet, aber dank leistungsfähiger Optik können auch einfachere DSO gut erreicht werden. Crayford-Auszug mit Untersetzung 1:11, Okularanschluss 2''. 2'' Okular 28mm. Zenitspiegel mit Reduzierung auf 1,25''. Brauchbares Sucherfernrohr 9x50. Gewicht des Tubus 3,7 kg.
Unistellar N 114/450 AZ - Das Crowd-Funding Projekt eVscope des von vier Phy
 sikern
2015 in Marseille gegründeten Startups Unistellar brachte
2020 das erste volldigitale Teleskop auf den Markt, ein
Newton (N) mit einem 4,5''-Objektiv, eingerichtet für die
Teilnahme an Community-Projekten. Die Basisvariante eQuinox
für 2800 Euro hat kein Okular, Bildgeber ist das auch zur
Steuerung benötigte Smartphone oder Pad. Die Version mit
digitalem Okular (eVscope 2) kostet 4500 Euro und leistet
etwas mehr: Sichtfeld 34x47 Bogenminuten, Auflösungsvermögen
1,33 Bogensekunden, Bildauflösung 7.7 Mpx. Maximale optische
Vergrößerung bei beiden Modellen: 50fach, digital 400fach.
Dioptrienausgleich -2.5 bis +2,5. Akku, WLAN, Autoalign,
GoTo, Nachverfolgung, Astrofotografie und Realzeit-Stacking
sind integriert. Gewicht Tubus und Montierung (fest
verbunden) 7,3 kg, Stativ 2,2 kg. Tubuslänge mit Montierung
67,5 cm. Unter 5 Grad Außentemperatur gibts Probleme mit der
Elektronik. Eher was für mehrere Nutzer, da der Wertverlust
rasch voranschreitet. Häufige Upgrades notwendig (Stand
2024).
sikern
2015 in Marseille gegründeten Startups Unistellar brachte
2020 das erste volldigitale Teleskop auf den Markt, ein
Newton (N) mit einem 4,5''-Objektiv, eingerichtet für die
Teilnahme an Community-Projekten. Die Basisvariante eQuinox
für 2800 Euro hat kein Okular, Bildgeber ist das auch zur
Steuerung benötigte Smartphone oder Pad. Die Version mit
digitalem Okular (eVscope 2) kostet 4500 Euro und leistet
etwas mehr: Sichtfeld 34x47 Bogenminuten, Auflösungsvermögen
1,33 Bogensekunden, Bildauflösung 7.7 Mpx. Maximale optische
Vergrößerung bei beiden Modellen: 50fach, digital 400fach.
Dioptrienausgleich -2.5 bis +2,5. Akku, WLAN, Autoalign,
GoTo, Nachverfolgung, Astrofotografie und Realzeit-Stacking
sind integriert. Gewicht Tubus und Montierung (fest
verbunden) 7,3 kg, Stativ 2,2 kg. Tubuslänge mit Montierung
67,5 cm. Unter 5 Grad Außentemperatur gibts Probleme mit der
Elektronik. Eher was für mehrere Nutzer, da der Wertverlust
rasch voranschreitet. Häufige Upgrades notwendig (Stand
2024).Skywatcher AC 120/600 - Ein günstiger und breit tauglicher Refraktor-Tubus mit weitem Sehfeld/Rich Field, 415 Euro (Stand August 2023). Amici-Prisma, Okulare (beides 1,25'') sowie Leuchtpunktsucher sind bescheiden, die Optik ist sehr ordentlich für diesen Preis, zweilinsiger Fraunhofer mit Farbsaumneigung v.a. bei höheren Vergrößerungen. Okularanschluss 2'', Adapter liegt bei, Okularauszug ohne Untersetzung. Öffnungsverhältnis 1:5. Auflösung unter einer Bogensekunde. Der Tubus wiegt 4 Kilogramm.
Celestron MC 127/1500 NexStar SLT AZ - Etwa 750 Euro kostet das Set aus einem vergrößerungsstarken Maksutov-Cassegrain (MC) Teleskop von 5'' und einer für den Transport vom Stativ zu trennenden azimutalen Einarm-GoTo-Montierung. Schwerpunkte sind Mond, Sonne (Schutzfilter nicht inklusive), Planeten und helle DSO. Mit wackeligem Leuchtpunktsucher, zwei bescheidenen Okularen 9mm (167fach) und 25mm (60fach). AP mit 40mm-Okular 3,4mm. Die Fokussierung läuft über den Hauptspiegel. Die Montierung ist manuell (ohne Motoren) nur in der Höhe, nicht im azimutalen Schwenk zu bedienen. Das Auflösungsvermögen liegt bei 0,91 Bogensekunden, die Genauigkeit von GoTo und Nachführung bei 16 Bogenminuten. Gesamtgewicht 8,2 kg.
Skywatcher Dobson Heritage 150/750 - Dieser Flextube-Dobson für ca. 310 Euro wird als "rucksacktaugliches Reiseteleskop" angepriesen. Mit 150mm Öffnung und einem Öffnungsverhältnis von 1:5 kann es mit diesem Newton schon weiter gehen zu Kugelhaufen, Nebeln und Galaxien. Helikaler Okularauszug, 1,25'' Okularanschluss, Okulare 10mm und 25mm, Leuchtpunktsucher. Der Tubus kann durch Einschieben des oberen Gestänges auf etwa die Hälfte verkürzt werden. Die Montierung ist einseitig, dennoch eher sperrig für den Rucksack, in der Höhe etwa wie der verkürzte Tubus, Basisdurchmesser ca. 300 mm. Tubus 3,5 kg, Montierung 4 kg. Es gibt dazu für ca. 175 Euro die GoTo-Ergänzung "Virtuoso GTi" mit Smartphone-Steuerung.
Omegon N 150/750 EQ - Etwa 350 Euro kostet dieses Teleskop mit EQ3-Montierung, ich würde aber EQ4 empfehlen, das kostet dann 70 Euro mehr, ist einiges stabiler und ein Polsucherfernrohr ist auch schon eingebaut. Mit 150mm Öffnung und einem Öffnungsverhältnis von 1:5 schon für einige Galaxien und Nebel tauglich. Auflösungsvermögen 0,77 Bogensekunden. Der Rotpunkt-Peilsucher ist wackelig, da sollte man sich Ersatz suchen bei Bedarf. Gesamtgewicht mit EQ4 13 kg.
Celestron Omni XLT R 150/750 EQ - Ja, das gibt es auch (wo und wie lange noch?), einen tauglichen Refraktor im beliebten 150/750-Bereich! Der Preis ist allerdings Stand Juli 2023 etwas happig im N-Vergleich, 1.200 Euro mit CG4-Montierung. Dafür deutlich stärker in Kontrast und Lichtleistung als die Newton-Varianten. Das Edelstahl-Stativ und die äquatoriale Montierung mit Feineinstellung sind gleichfalls anspruchsvoll. Gesamtgewicht 13 kg, Gegengewichte 1,8 kg. Es gibt für 350 Euro weniger auch eine Newton-Ausführung, die ist noch schwieriger zu bekommen.
Skywatcher Star Discovery N 150/750 AZ - Eine äußerst preisgünstige GoTo-Ausstattungen für Einsteiger zu 630 Euro, die wie die anderen 150/750-Modelle schon den Galaxienbereich aufschließt, zumal dank des integrierten SynScan WiFi-Moduls. Wundersame Genauigkeit beim Finden darf man allerdings zu diesem Preis so wenig erwarten wie bei der GoTo-Montierung für den Skywatcher Heritage Dobson oder der für das Celestron 127/1500. Tubusgewicht 4 kg, die Montierung trägt 5 kg und wiegt mit Stativ 6,5 kg. Anspruchsvoller, aber auch mehr als doppelt so teuer ist das Skywatcher 150/750 PDS Explorer mit der tragfähigeren Montierung EQ5.
Skywatcher N 200/1000 EQ - Zu einem Preis von etwa 850 Euro bekommt man hier mit der EQ5-Montierung (ohne Polsucher) von Skywatcher schon ein Gerät, das mit seinen 8'' und einem Öffnungsverhältnis von 1:5 auch bei etwas schwierigeren Nebeln und Galaxien mithalten kann. Auflösungsvermögen 0,58 Bogensekunden. 2''-Okularanschluss. Den Newton-Tubus alleine gibt es schon unter 500 Euro, mit gut brauchbarem Sucherfernrohr 9x50. Wegen der ersten Spiegel-Justierung sollte man, sofern man nicht bereits einschlägige Schrauberfahrung hat, bei einem kleineren Händler kaufen, der das vor Versand erledigt. Gewicht Tubus alleine 8,8 kg, Montierung EQ5 mit Stativ ohne Gegengewichte 11 kg. Das Gewicht des Tubus führt die Montierung an ihre Grenzen!
TS-Optics Photon N 200/1000 OTA - Ein ausgefeilter 8''-Tubus für etwa 550 Euro. BK7-Glas für den Hauptspiegel mit 94% Reflexion, Auflösungsvermögen 0,58 Bogensekunden, 2''-Crayford-Auszug mit 1:10 Untersetzung und 1,25''-Reduzierung, großer Backfokus. Sucherfernrohr 8x50. Tubus aus Stahl, Gewicht 9 kg. Die passende Skywatcher EQ5 Montierung kostet etwa 440 Euro, sie trägt bis 10 kg und wiegt 11 kg ohne Gegengewichte. GoTo gibt es z.B. mit der Bresser Messier EXOS 2, die inklusive Polsucherfernrohr 830 Euro kostet. Sie trägt bis zu 13 kg, wiegt 11,4 kg ohne Gegengewichte.
Celestron SC 203/2032 NexStar Evolution 8 AZ - Ein extrem leichter 8'' Schmidt-Cassegrain-Tubus (SC) mit einem langsamen Öffnungsverhältnis 1:10 sowie eine umfassend ausgestattete GoTo-AZ-Montierung bieten Komfort für etwa 2800 Euro. Auflösungsvermögen 0,57 Bogensekunden. Okularanschluss 1,25''. AP mit 40mm-Okular nur 4mm, die Stärke liegt in der Vergrößerung. Zubehör sind zwei Okulare 13mm (156x) und 40mm (51x) und ein bescheidener Leuchtpunktsucher - aber auch ein leistungsfähiger integrierter und entnehmbarer Akku zur autonomen Stromversorgung und ein integriertes WLAN-Modul. Tragkraft Montierung 11 kg. Tubuslänge 43,2 cm, Tubusgewicht 5,7 kg. Montierung mit Stativ 12,4 kg.
Orion VX10 N 250/1200 OTA - Ein leichter 10''-Tubus aus UK für etwa 1.000 Euro zu Anfang des Jahres 2022, 1.500 Euro Ende 2022 und Anfang 2024 wieder zurück auf 1.100! Öffnungsverhältnis 1:4,8 für lichtschwache Objekte. 1:10 untersetzter 2''-Crayford-Fokussierer, Hauptspiegel mit 97% Reflexion und Belüftung, Sucher 8x50. Tubus aus Aluminium, Länge 114 cm, Gewicht 11 kg. Zu ihm passt z.B. die Skywatcher EQ6-R Pro SynScan GoTo-Stativmontierung für ca 1.750 Euro, sie trägt bis zu 20 kg. Gewicht Achsenkreuz 16 kg, Stativ 8,8 kg, Gegengewichte 10 kg.
Bresser Messier Dobson 254/1270 - Zu einem Komplettpreis von 600 Euro ist dieser 10-Zöller von Bresser mit einem Öffnungsverhältnis 1:5 und einem shiftingfreien 2,5'' Hexafoc Fokussierer ein besonders preisgünstiges Gerät für Ausflüge zu Nebeln und Galaxien. Sucher 6x30, Okular 25mm. Gewicht des Tubus 13 kg, Länge 132 cm. Gewicht Rockerbox 16 kg, Höhe 51 cm. Der Tubus kann auch auf entsprechend tragfähigen EQ-Montierungen verwendet werden.
Meade ACF-SC 305/3048 LX90 - Der Preis für dieses Gerät liegt bei etwa 4.400 Euro. Die Cassegrain-Optik mit 12'' Öffnung ist Advanced Coma Free (ACF), UHTC-beschichtet und mit dem Öffnungsverhältnis 1:10 universell einsetzbar. Auflösungsvermögen 0,38 Bogensekunden, Genauigkeit GoTo/Nachführung 3 Bogenminuten. AP mit 40mm-Okular nur 4mm, Stärke liegt in der Vergrößerung. Die GoTo-Montierung in Gabelform gilt als extrem schwingungsstabil, das Stahlstativ unterstützt dies. Das "assisted alignment" nähert sich dem Autoalignment. GPS ist integriert, ein Akku nicht. Ein elektronischer Fokussierer kann optional angeschlossen werden. Zubehör sind ein 8x50 Fadenkreuzsucher und ein 26mm Okular. Die Kollimation ist einfach zu machen und im deutschen Handbuch verständlich beschrieben. Eher was für die Hütte oder die Amateursternwarte auf dem Dach: Der Tubus mit Montierung bringt 27 kg auf die Waage (und den Rücken!), das Stativ nochmal 9 kg.
Omegon ProDob Dobson 406/1850 - Der 16-Zoll-Gitterrohrdobson von Omegon bringt Galaxien äußerst günstig näher, für ca. 2.100 Euro. Hauptspiegel mit Enhanced Coating und 94% Reflexion, Auflösungsvermögen 0,34 Bogensekunden. 32mm-Okular, 2''-Crayford-Auszug mit 1,25'' Adapter und 1:10 Untersetzung, Hauptspiegellüfter, Leuchtpunktsucher. Die Rockerbox hat Nadellager (Azimut) und Kugellager (Höhe). Das preisgünstige Vergnügen hat sein Gewicht: Tubus alleine 35 kg, Rockerbox 30 kg.
Taurus Dobson 404/1800 Professional SMH - Für 4.900 Euro gibt es diesen Leichtbau-Dobson aus Polen. 96% Reflexion der beiden Spiegel. Auflösungsvermögen 0,34 Bogensekunden. 2''-Crayford-Auszug mit 1:10 Untersetzung. Fangspiegelheizung. Ohne Sucherfernrohr und Okular. Einfache werkzeuglose Kollimation. Rockerbox mit Teflonpads. Tubuslänge 1280 mm, Gewicht Tubus (Aluminium) 12,5 kg, Gewicht Rockerbox 18,5 kg.
Spacewalk Leichtbau-Dobson 500/1600 "Horizon" - Mit 37 kg Gesamtgewicht (zerlegbar) ist der 20''-Dobson aus der Manufaktur von Christian Busch in Karlsruhe noch gut händelbar für den Transport bei entsprechender Fitness. Damit sind dann schon Exkursionen bis zum Corona Borealis Supercluster in 1.000.000.000 Lichtjahren Entfernung möglich! Was allerdings nicht nur einen hohen zeitlichen und technischen Aufwand erwartet (z.B. Anreise zum passenden Seeing), sondern auch die finanzielle Investitionsbereitschaft mit ca. 9.500 Euro herausfordert. In der Serie "Infinity" ist ein 20-Zöller für 6.400 Euro zu bekommen. Auch der "Infinity" 16-Zöller ist hochinteressant.
3.6 Montierung
Die Montierung verbindet Stativ und Teleskop, ähnlich wie der Stativkopf für den Fotografen Stativ und Kamera. Häufig sind Teleskopmontierungen bereits fest mit einem Stativ verbunden. Spezifische Teleskopstative sind sehr typenabhängig, weshalb ich hier auf sie nicht eingehe. Ein Sonderfall ist die auf Boden oder Tisch stehende Rockerbox, die (Quasi-)Stativ und Montierung in einem ist, für Dobsons.Wie ich oben unter 2.1 schon ausgeführt habe, gibt es zwei grundverschiedene Typen von Montierungen, die parallaktische/äquatoriale (EZ) und die azimutale (AZ). Nur diese beiden Typen ermöglichen ein exaktes Ansteuern von Objekten nach Koordinaten. Ein Kugelkopf, wie ihn Newton bei seinem ersten Teleskop eingesetzt hat, und wie wir ihn aus der Fotografie und vom Filmen kennen, ist grundsätzlich auch nutzbar, aber nur für das "freihändige" Ansteuern. Es gibt für die Teleskopie "azimutale" Kugelköpfe, die prinzipiell auch über Motoren (und damit potentiell auch mit Software) gesteuert werden könnten, aber das wäre dann technisch sehr aufwendig und teuer.
Der erste Ansatz zu einer parallaktischen Montierung wurde schon um 1610 vom Jesuiten Christoph Grienberger an der ersten Vatikanischen Sternwarte, dem "Turm der Winde", für das Heliotrop zur Sonnenbeobachtung entwickelt - und es ist anzunehmen, dass er sie nicht nur dafür nutzte. Die ersten Montierungen mit azimutalem Ansatz waren Kugelköpfe, bekannt ist der Kugelkopf unter dem legendären Teleskop Newtons von 1668 (wenn die Überlieferung der Royal Society London richtig ist). Dann folgten aber rasch mit der Größenzunahme der Teleskope Rockerbox-ähnliche Montierungen, schön zu sehen etwa beim Herschel-Teleskop von 1790 aus dem Teylors-Museum Haarlem, ein Newton-Teleskop, das bereits gewaltige Ausmaße angenommen hatte.
Parallaktische (äquatoriale) Montierungen gibt es heute in zwei Ausführungen, als "deutsche Montierung" und als Gabelmontierung. Die 1820 von Joseph von Fraunhofer entwickelte deutsche Montierung benötigt Gegengewichte, die Gabelmontierung durch ihre beiden Fixierungen nicht. Die deutsche Montierung ist für unterschiedliche Teleskope nutzbar, während die Gabelmontierung speziell einem Tubus angepasst ist. Die beiden Achsen der parallaktischen Montierung können auf einem Montierungssockel im Prinzip beliebig gedreht und gekippt werden. Die Hauptachse wird als Polachse, Stundenachse oder Rektaszensionsachse bezeichnet. Die Aufstellung einer parallaktischen Montierung hat ihre besonderen Ansprüche und sollte in Ruhe im Zimmer, warm, trocken und hell, möglichst mit einem Nordfenster, geübt werden. Die Polachse ist auf den Himmelspol auszurichten, der in der Nähe des Polarsterns liegt. Und dann muss noch mit Gewichten für die Rektaszensionsachse und am Tubus für die Deklinationsachse austariert/balanciert werden. Das sollte aber nicht schrecken, ist einfacher zu machen als ein manuelles Alignment mit der azimutalen Montierung.
Azimutale Montierungen können schlichtweg mehr tragen als die komplexer aufgebauten parallaktischen. Sie sind weniger sperrig und bei gleicher Stabilität leichter, zumal sie ohne Gegenwichte auskommen. Sie sind auch schneller einsatzfähig. Es gibt sie als einfachen Stativkopf, mit einem Arm oder als Gabelmontierung. Wobei die Varianten mit Stativkopf und einem Arm unterschiedliche Teleskope tragen können, die mit Gabel sind einem bestimmten Teleskop angepasst und werden in der Regel nur mit diesem zusammen verkauft.
Durch eine Polhöhenwiege lässt sich eine azimutale Montierung zur quasi-parallaktischen mit einer dritten Achse, der Nachführungsachse, erweitern - allerdings nicht in nördlichen Breiten und nur mit leichteren Teleskopen, sonst kippt der Aufbau. Dabei gibt es einfache Polhöhenwiegen ohne Nachführung, die zwischen Stativ und Montierung eingebaut werden können - sofern die Montierung nicht, wie bei GoTo üblich, mit dem Stativ eine feste Einheit bildet. Die gibt es auch mit Nachführungsautomatik, etwa die Mini Track LX 3 für leichtere Geräte bis 3 Kilogramm Gewicht. Sie ermöglicht eine exakte automatisierte Nachführung über ein Federwerk. Nach der Justierung auf den Nordstern und der Zentrierung eines Objektes im Teleskop oder in der Kameraoptik kann die Nachführung starten. Sie läuft bis zu etwa einer Stunde!
Ein Sonderfall sind die EQ-Plattformen für Dobsons, die gleichfalls eine automatisierte Nachführung leisten. Die gibt es für Dobsons bis 50kg Gewicht und für einen Einsatz bis zum 60. Breitengrad. Die Nachführung mit einer Plattform ist auf etwa eine Stunde beschränkt. Dann geht es zurück auf Null, mit Neuausrichtung der Optik auf das Objekt.
Auch kann umgekehrt eine parallaktische Montierung azimutal verwendet werden. Dazu muss lediglich der Breitengrad auf Null gestellt werden (Äquatorbreite). Allerdings macht das selten Sinn und ist mit viel Geschraube hin und zurück verbunden.
Last not least: Das Stativ, oft mit der Montierung verbunden, sollte stabil sein! Billigstative können jede Beobachtungsnacht verderben. Stahl ist schwerer, aber daher auch stabiler und vibrationsärmer als Aluminium.
Exkurs: GoTo-Montierung
AZ-GTiX von Skywatcher
Diese Montierung wird als "Reisemontierung"
angeboten, und das sollte man ernst nehmen! Die maximale
Belastung einseitig ist mit 6 Kilogramm angegeben,
zweiseitig mit 10 Kilogramm. Bei diesen Belastungen wird es
aber für den Motor bereits mühsam und bei azimutalem
händischem Schwenk ist die Reibung spürbar grenzwertig. Bei
einseitiger Belastung ohne Gegengewicht würde ich nicht über
4 Kilogramm gehen, zweiseitig scheinen mir 10 Kilogramm
machbar. AZ steht für "azimutal" und GT für "GoTo". Ein
lokales WiFi-Modem ist integriert.Die Montierung kann zwei optische Geräte aufnehmen, vorgesehen ist (kleiner) Tubus
 plus Kamera, ich verwende sie für Tubus plus Fernglas oder
nur Tubus bzw. Fernglas mit Gegengewicht. Die beiden Geräte
können ohne großen Aufwand aufeinander justiert werden. Der
erste Tubus kommt rechts an eine Schwalbenschwanz-Aufnahme,
ein zweiter Tubus oder das andere Gerät (Kamera, Fernglas,
Spektiv ...) links auf einen L-Träger mit
Schwalbenschwanz-Aufnahme. Mein 127er Maksutov-Tubus hat den
Schwalbenschwanz/die Profilschiene/Prismenschiene auf der
rechten Seite, ich muss daher ggf. gedreht montieren,
weshalb der Peilsucher nach unten hängt - was aber auch
funktioniert. Das Foto rechts zeigt die Montierung mit
APM-Fernglas 20x110 - vom Gewicht her (5,6 kg) grenzwertig!
Das Foto soll nur zeigen, was mit der Montierung zu machen
ist, das ist keine Kombinations-Empfehlung! Winkeleinblick
und Geradblick zusammen macht wenig Sinn - es sei denn, man
möchte in einer Sitzung zuerst mit dem Fernglas in mittlerer
Höhe unterwegs sein und dann mit dem Teleskop weiter nach
oben gehen.
plus Kamera, ich verwende sie für Tubus plus Fernglas oder
nur Tubus bzw. Fernglas mit Gegengewicht. Die beiden Geräte
können ohne großen Aufwand aufeinander justiert werden. Der
erste Tubus kommt rechts an eine Schwalbenschwanz-Aufnahme,
ein zweiter Tubus oder das andere Gerät (Kamera, Fernglas,
Spektiv ...) links auf einen L-Träger mit
Schwalbenschwanz-Aufnahme. Mein 127er Maksutov-Tubus hat den
Schwalbenschwanz/die Profilschiene/Prismenschiene auf der
rechten Seite, ich muss daher ggf. gedreht montieren,
weshalb der Peilsucher nach unten hängt - was aber auch
funktioniert. Das Foto rechts zeigt die Montierung mit
APM-Fernglas 20x110 - vom Gewicht her (5,6 kg) grenzwertig!
Das Foto soll nur zeigen, was mit der Montierung zu machen
ist, das ist keine Kombinations-Empfehlung! Winkeleinblick
und Geradblick zusammen macht wenig Sinn - es sei denn, man
möchte in einer Sitzung zuerst mit dem Fernglas in mittlerer
Höhe unterwegs sein und dann mit dem Teleskop weiter nach
oben gehen.Gesteuert wird die Montierung über eine Skywatcher Handsteuerung oder die SynScan-App. Die SynScan-App verfügt über den Datenbestand von über 10.000 Objekten (die Angaben weichen stark voneinander ab) und hat ein komfortables Steuerungsfeld, das auch diagonale Bewegungen ermöglicht. Die Motorengeschwindigkeit ist einfach zu regulieren und hat 9 Stufen. Die erweiterte App SynScan Pro erlaubt auch die fotogenaue Steuerung äquatorialer/parallaktischer Montierungen. Es kann auch SkySafari Pro mit seinem großartigen Planetarium zum Ansteuern von GTiX genutzt werden, allerdings muss das Alignment zunächst mit SynScan gemacht werden. SkySafari holt sich die Daten von SynScan, wenn auf SkySafari bei den Settings unter Teleskop Presets "SynScanLink" gewählt wird. Achtung mit dem voreingestellten Teleskop-Setting "Tilt Device to Slew" bei Safari, da passieren schnell mal in der Nacht ungewollte Teleskopbewegungen. Slew-Geschwindigkeit auch gleich reduzieren, sonst ist wusch das Objekt weg. Meine Erfahrungen beziehen sich auf die Steuerung über iPhone.
Nachführung schafft diese Montierung auch ohne Alignment, dazu ist ein Objekt manuell anzufahren - mit den Händen bei gelösten Arretierungen oder mit dem sehr tauglichen Steuerungsfeld der App. Das Alignment für GoTo ist unkompliziert zu machen, in zwei Varianten - allerdings ist das GoTo azimutal eher ungenau. Die einfache Variante, "Default Pointing", wird erreicht durch Ausrichten der Montierung vor dem Einschalten auf den geografischen Norden ("True North"), der z.B. beim iPhone über die Kompass-Einstellung bestimmt werden kann (voreingestellt). Also nicht auf den Polarstern ausrichten, Tubus waagrecht! Das "echte" Alignment kann wiederum in zwei, bei der Pro-Ausführung der App in vier Varianten durchgeführt werden, mit zwei besonders hellen Sternen/Planeten oder mit "North Level", wenn gerade keine zwei der besonders hellen Objekte bequem zugänglich sind, dann auch mit Ausrichtung nach "True North". Die Pro-Ausführung bietet auch Align mit drei Sternen an - was dann genauer wird. Das Alignment kann vor Abschalten der Montierung gespeichert werden unter den Utilities (etwas irreführend auf deutsch: "Zubehör") mit der Utility "Hibernate" ("Winterschlaf").
Was besonders bemerkenswert ist an dieser Montierung in Verbindung mit SynScan Pro ("Settings: Advanced: Auxiliary Encoder"): Das Alignment bleibt erhalten, wenn zwischendurch händisch ausgerichtet wird!
Fazit: Die Reibungsbremse bei höherer Beladung - vor allem wenn nur einseitig - ist hoch. Die Nivellierungs-Bubble an der Montierung taugt nichts - jedenfalls bei meinem Exemplar. Ich verlasse mich auf die Bubble am Stativ. Die Arretierungen für die Prismenschienen sind primitiv und hinterlassen Schrammen. Nachführung ok, GoTo eher wenig zufriedenstellend, da muss man viel ausprobieren - zumal die Handbücher teils kryptisch bis widersprüchlich sind. Als App gleich SynScan Pro nehmen, SkySafari Pro greift auch lieber darauf zu. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei unter 500 Euro (Stand Mai 2023) ordentlich.
3.7 Sucher
Vor allem für das Alignment, also die Einstellung des Teleskops bzw. der Steuerungssoftware auf den aktuellen Sternenhimmel, und bei hoher Vergrößerung im Okular ist ein Sucher unabdingbar zum Auffinden der Objekte. Zum Alignment müssen die Objekte zunächst im Sucher, dann mit feinerer Motorensteuerung im Okular zentriert werden.Ganz einfache Sucher sind Peilrohre oder Projektionssucher mit Scheibe oder rundem Durchblick, auf die ein Sucherpunkt oder Sucherkreis geworfen wird (Leuchtpunktsucher, Telrad-Sucher). Sie haben den Vorteil, dass mit scharfen Augen gut Himmel und Sucherbild nebeneinander gesehen werden können, ohne Vergrößerung. Großer Nachteil der Projektionssucher: Sie benötigen eine Knopfbatterie und sind störungsanfällig. Wer eine Brille trägt, diese aber beim Teleskopieren nicht benutzt, da die Sehschärfe noch ausreicht für die Orientierung, wird mit diesen Suchern eher nicht glücklich, da er (oder sie) immer wieder die Brille aufsetzen muss, um besser zu sehen, was sich im Sucher zeigt.
Gute Alternativen sind Sucher mit Vergrößerungsoptik, kleine Fernrohre also. Durch die Vergrößerung weicht ihr Bild vom Himmelsanblick ab. Um die Verwirrung gering zu halten, sollten sie möglichst ein aufgerichtetes und seitenrichtiges Bild liefern, da das Sucherbild stets mit dem realen Bild abgeglichen werden muss für die Positionsbestimmung bzw. die Zentrierung auf ein gewünschtes Objekt. Geradsichtige Sucher zeigen häufig nur ein kopfstehendes und seitenverkehrtes Bild. Winkelsucher dagegen bieten in der Regel mit einem Amici-Prisma ein korrektes Bild an. Wichtig ist auch ein taugliches Fadenkreuz in der Sucheroptik. Bei manchen Modellen kann das beleuchtet werden, was theoretisch gelegentlich hilfreich sein kann, praktisch aber erstens teurer ist und zweitens öfter mal Knopfbatterienwechsel erfordert (zumal wenn man vergißt es auszuschalten) und drittens bisweilen, etwa bei Frost, ausfällt.
Geradsichtige Sucher haben den Vorzug, dass sie die Peilung zu den Objekten erleichtern im Wechsel von Vorbeiblick und Durchblick. Winkelsucher beugen dagegen Nackenschmerzen und Verrenkungen des Rückens vor, die bei geradsichtigen Suchern, die auf hochstehende Objekte gerichtet sind, fast zwangsläufig entstehen. Es macht daher bisweilen Sinn, zwei Sucher zu montieren am Tubus. Eventuell dazu noch einen Leuchtpunktsucher oder diesen statt des geradsichtigen optischen Suchers. Dazu gibt es spezielle Sucherhalterungen, etwa den Omegon Tri-Finder, die in den Schuh am Teleskoptubus geschoben werden und die Montierung von bis zu drei Suchern erlauben. Darauf achten, dabei nicht die Gewichtsgrenze der Montierung/des Stativs zu überschreiten!
Sucher müssen vor dem Einsatz obligatorisch justiert werden, also abgestimmt mit dem Bild, das wir im Teleskopokular sehen. Dazu wird ein fernes Objekt - etwa ein Kirchturm oder der Polarstern - im Teleskopokular zentriert und danach mit den Stellschrauben am Suchertubus in die Mitte des Sucherbildes geführt. Diese Justierung ist bei wackligen Leuchtpunktsuchern aus Plastik sehr häufig durchzuführen, sollte aber auch bei anderen Suchermodellen nicht vernachlässigt werden.
Exkurs - TS-Optics 8x50 Winkelsucher
Ich möchte keine Werbung für bestimmte Produkte machen, sondern sachlich vor dem Hintergrund meiner und allgemeiner Erfahrungen exemplarisch informieren. Was zu diesem Sucher gesagt wird, lässt sich übertragen - positiv oder ex negativo - auf andere Suchermodelle.Der Sucher von TS-Optics hat eine komfortable Öffnung, die viel Licht sammelt mit einem achromatischen Objektiv von 50mm Durchmesser. Das Objektiv ist multivergütet und besteht aus zwei Elementen. Mit 8-fach vergrößert dieser Sucher ausreichend, so dass schon Details sichtbar werden, aber nicht zu sehr, damit das Sichtfeld noch weit genug bleibt und Störungen gering. Die hohe Lichtsammelleistung macht auch schwächere Sterne zumal bei Lichtverschmutzung gut sichtbar. Er ist gut zu justieren mit den beiden Rändelschrauben, denen eine Feder gegenhält. Die Einstellachsen verlaufen diagonal.
Das Fadenkreuz im Okular ist fein genug, um Sterne nicht über Gebühr zu verdecken. Der Winkeleinblick bietet ein seitenrichtiges, aufrechtes und brillantes Bild - was nicht selbstverständlich ist bei diesem günstigen Preis (Januar 2022 unter 110 Euro). Da beim Aufsuchen öfter zwischen realem Bild und Sucherbild gependelt wird, ist die realitätstreue Abbildung durchaus sinnvoll. Die Scharfstellung funktioniert vorne am Objektiv, mit Rein- und Rausdrehen - etwas schlicht, aber praktisch, preiswert und gewichtsparend. Der Tubus kann in der Halterung gedreht werden. Daher sollte die Fokussierung vor der Justierung stattfinden, da sonst die Justierung wieder verloren geht.
Durch die Möglichkeit zur Fokussierung ist der Sucher auch für Brillenträger gut nutzbar, welche die Brille beim Teleskopieren nicht unbedingt benötigen. Das ist ein großer Vorteil gegenüber den preisgünstigen Leuchtpunktsuchern, bei denen solche Brillenträger für den Sucherblick die Brille aufsetzen müssen, um ein scharfes Bild im Sucher zu bekommen.
Die Montage ist einfach, da der Fuß in die üblichen Schwalbenschwanz-Träger passt. Die gesamte Halterung mit Fuß ist aus Metall, was eine beachtliche Stabilität schafft. Der Halt ist zudem optimiert durch eine genormte Spundung (Feder am Fuß). Für die Stabilität weniger wichtige Teile sind aus Kunststoff, weshalb das Gewicht mit 480 Gramm erfreulich niedrig bleibt, trotz hoher Leistung.
Ich kann nur davor warnen, beim Sucher sparen zu wollen. Ein dürftiger Sucher kostet viel Zeit und Nerven, vor allem beim Alignment.
3.8 Steuerungs- und Auffindhilfen
Vier Themen machen Einsteigern großes Kopfzerbrechen, 1. wie weiß ich, was ich da am Himmel gerade vor mir sehe, 2. wie weiß mein Teleskop, wo es gerade hinschaut, 3. wie bringe ich mein Teleskop dazu, dorthin zu fahren, wo ich etwas betrachten möchte und 4. wie kann ich dem, was ich dann anschaue, hinterhergehen mit dem Teleskop, wenn das Objekt meiner Begierde doch ständig aus dem Bildfeld wandert!? Der erste Punkt ist traditionell mit Himmelsatlanten und Sternenkarten, heute zunehmend dank hilfreicher Smartphone-Apps (ich selbst benutze unterwegs auf dem iPhone Sky Guide, am MacBook SkySafari) erfolgreich zu bearbeiten. Die drei anderen Punkte benötigen entweder viel Zeit und Übung - und dann bin ich es, der etwas weiß und macht, nicht mein Teleskop. Oder aber ich verwende geeignete elektronische Hilfsmittel. Und um diese geht es hier. Voraussetzung ist selbstredend, dass die Montierung über Motoren gesteuert wird.Dem Teleskop beizubringen wohin es schaut, wird durch das Alignment geleistet. Die komfortabelste Möglichkeit ist das Autoalign. Dazu gehört eine Kamera, etwa die im StarSense AutoAlign Modul von Celestron. Es kann auch eine Astrokamera sein, die ans Okular oder an spezielle Suchern montiert wird. Viele Einsteiger quälen sich allerdings zunächst mit dem händischen Alignment ab, bemühen sich mehr oder weniger verzweifelt, nacheinander zwei (bei parallaktischen Montierungen) oder drei (bei azimutalen Montierungen) markante Sterne anzusteuern und deren Positionen für die Software abzuspeichern, die dann die Position des Teleskops zum Himmel berechnet. Irgendwann klappt das auch, Geduld!
Nach dem Autoalign oder dem händischen Align mit der Meldung "Alignment completed", kann das Ansteuern von Himmelsobjekten zur Beobachtung beginnen, das eigentliche "GoTo". Wie exakt ein Objekt dann aufgefunden wird, hängt zum einen von der Genauigkeit des Alignments ab, zum anderen von der Qualität der Ausrüstung und der Abstimmung der Software auf die Teleskop-Montierungs-Hardware.
Und nicht mit jeder Kombination ist das Gewünschte zu erreichen! Ich hab z.B. mit Sky Safari Pro 6 unter Mac OS das Alignment probiert. Alles easy nach den Beschreibungen. Aber stellt euch einfach vor, ihr sollt nachts über das Laptop euer Teleskop auf drei verschiedene Sterne exakt ausrichten. Die Pfeiltasten an der Tastatur werden von Sky Safari nicht aktiviert. Ihr müsst die Steuerung an der Steuereinheit (Scope Control) auf dem Bildschirm mit dem Mauszeiger besorgen, den ihr über das Touchfield auf die entsprechende Richtungstaste (rechts, links, oben, unten) setzt. Und gleichzeitig sollt ihr durch den Sucher oder das Okular schauen ob das Teleskop in die passende Richtung wandert und der Stern schließlich im Zentrum ankommt. Das ist schlechterdings unmöglich! Jedenfalls nicht mit vertretbarem Zeit- und Nervenaufwand. Irgendeine Lösung findet sich immer, klar. Aber nicht immer die aus den netten Tutorials.
Die Nachverfolgung von Objekten ist einfacher zu regeln. Da gibt es sogar mechanische Teile, Polhöhenwiegen oder Tracker, die ohne Stromversorgung nach der Ausrichtung auf den Himmelspol dies leisten können. Wer mit GoTo arbeitet, hat diese Funktion bereits in die Software integriert. Dabei gibt es siderale, lunare und solare Nachführgeschwindigkeiten angeboten. Planeten fallen unter die siderale. Die Eigenbewegung der Planeten fällt kurzzeitig nicht ins Gewicht und müsste ohnedies dann für jeden Planeten separat korrigiert werden.
Exkurs - Celestron
WLAN-Modul Sky Portal
Dieses WLAN-Modul benutze ich, um gelegentlich ein Celestron
NexStar 127/1500 mit dem Smartphone zu steuern. Was ich hier
ausführe, lässt sich übertragen - positiv oder ex negativo -
auf andere Steuerungshilfen.
Das Teil kann durchaus was, ist aber überteuert. Es gibt zwei Möglichkeiten der kabellosen Verbindung, einmal direkt zwischen Modul und PC/iPad/Smartphone, einmal über externes WLAN ("Access-Point"). Für den Normalgebrauch genügt die direkte Verbindung, die bis etwa 6 Meter reicht und einfacher einzurichten ist. Allerdings ist diese Verbindung offen/ungesichert und zudem störungsanfällig bei nahem WLAN-Verkehr. Bei Verbindungsabbrüchen sollte man den Standort wechseln, da können ein paar Meter genügen, oder auf Access Point umstellen.
Mit Windows ist sie Steuerung über ein Kabel und kostenlos erhältliche Software günstiger zu bekommen. Für das NexStar 127/1500 verwende ich ein Mini-USB auf USB-Kabel für die Verbindung Handsteuerung-Computer und als Software CPWI von Celestron. Mit CPWI lässt sich das Teleskop allerdings nicht über einen berührungsempfindlichen Bildschirm steuern, doch zumindest über die Pfeiltasten an der Tastatur.
Wie normale Menschen ohne vier Arme und zwei Köpfe ein gutes Alignment über den PC hinbekommen, ist mir ein Rätsel. Gleichzeitig im Sucher oder Okular zum Zentrieren das Objekt im Auge behalten und am PC die Teleskopmotoren zu steuern, erfordert schier übermenschliche Fähigkeiten. Mit den Pfeiltasten geht es noch, aber Sky Safari Pro 6 am Mac kann z.B. keine Steuerung über die Pfeiltasten der Tastatur initiieren (Stand Ende 2021). Da muss über das Touchpad der Bildschirmzeiger auf die Steuerungseinheit von Sky Safari geführt werden, um dort die vier Pfeilsymbole für rechts, links, unten, oben zu aktivieren. Und dabei soll ich noch durch Sucher oder Okular schauen? Dann doch lieber mit der Handbedienung des Teleskops arbeiten und eben öfter mal Standortkoordinaten und Zeit eingeben müssen. Manche Montierungen schaffen es allerdings, Handsteuerung und WLAN-Steuerung zu verkoppeln.
Am iPhone kann ich das Teleskop drahtlos steuern ohne mich zu verrenken. Die dazu notwendige Software/App SkyPortal von Celestron (aus SkySafari entwickelt bzw. verschlankt) gibts umsonst. Sonderlich komfortabel ausgestattet ist sie nicht, aber gut handhabbar. Der kleine Bildschirm ist nach dem Alignment dann zur Zielauswahl nicht optimal, meist hab ich noch ein Laptop mit dabei, auf dem ich mich mit Sky Safari Pro orientiere, ehe ich die Objekte dann übers iPhone ansteure. Allerdings, wer das StarSense Autoalign hat, braucht das WLAN-Modul nicht mehr zum bequemeren Alignment, kann dann aber besser Objekte über das Smartphone per Himmelskarte ansteuern.
Wer die interessante Starry Night Software zur kabellosen Steuerung verwenden möchte, benötigt das noch heftiger überteuerte SkyFi III-Modul von Starry Night. Es zeigt sich wieder einmal: Bei jeder Anschaffung im Teleskopier-Bereich sollten auch die eventuellen Folgekosten mit bedacht werden - und wie ein Teil zum andern passt.
Fazit: Integriertes WLAN ist eindeutig überlegen und in der Gesamtrechnung auch billiger. Kabelsteuerung kann nach wie vor eine gute Alternative sein - entweder über die Handbedienung oder über das Laptop. Sie ist weniger störungsanfällig - wenn man nicht gerade über das Kabel stolpert.
3.9 Okulare, Linsen, Filter
Okulare gibt es wie Sand am Meer, in verschiedenen
Ausführungen und höchst unterschiedlichen Preisklassen.
Für den Einstieg genügen drei Okulare mittlerer
Qualität, eines mit langer Brennweite und somit geringer
Vergrößerung (20-40fach) zur Orientierung und zum
Aufsuchen der Objekte sowie für besonders ausgedehne
Objekte, eines mittlerer Brennweite (Vergrößerung
40-80fach) für Nebel und Galaxien und eines mit kurzer
Brennweite und damit hoher Vergrößerung (80-200fach) für
Mond und Planeten. Natürlich sind das nur Faustregeln, wer
Galaxienhaufen auflösen möchte, braucht (vorausgesetzt,
das Teleskop/Dobson hat die notwendige Lichtstärke) auch
ein hohe Vergrößerung und so gibt es weitere Sonderfälle.
Nach einiger Erfahrung solltest du in ein Set mit
fokusidentischen Okularen investieren, um dir beim
Objektivwechsel die Neufokussierung zu ersparen.
Dazu kann ein Zoomokular Spass machen und das
Aufsuchen/Beobachten erleichtern. Es erfreut bei
Doppelsternen mit der bildlichen Trennung der Partner. Ein
Weitwinkel-Okular macht Sinn für große Nebel und
Galaxien, um einen schönen Gesamteindruck zu bekommen.
Aber Achtung, Weitwinkel ist teuer und kann eher selten
sinnvoll eingesetzt werden. Ein Fadenkreuzokular
(Brennweite üblicherweise 12,5mm) wird zur Justierung des
Suchers und für das Alignment empfohlen, falls man keine
Ausrüstung mit Autoalign hat. Aber ist das Auge nur ein
bisschen schräg angesetzt, stimmt die Zentrierung auch mit
Fadenkreuz nicht. Ich ziehe zur Justierung des Suchers ein
einfaches Okular mit höherer Vergrößerung dem
Fadenkreuzokular vor. Und bei Tuben mit langen Brennweiten
ist ein Fadenkreuzokular fürs Alignment eher lästig, da
die Objekte rasend schnell wieder aus dem Bildfeld
verschwinden.
Jeder kennt sie, aber wer braucht sie wirklich - die Barlow-Linse?
In der Normalausführung verdoppelt sie die mögliche
Vergrößerung eines Teleskops durch eine Verdoppelung der
Brennweite. Da sie die Öffnung des Objektivs nicht auch
verdoppeln kann, ist der Effekt nicht unproblematisch und
meist bringt ein Okular mit geringerer Brennweite
qualitativ mehr zur Steigerung der Vergrößerung, besonders
im Vergleich mit preisgünstigen Barlow-Linsen. Für
Detailaufnahmen in der Planetenfotografie oder eine
bessere Aufgliederung ferner Galaxienhaufen mit einem
besonders lichtstarken Teleskop kann eine qualitativ
anspruchsvolle Barlow-Linse durchaus hilfreich sein.
Ebenso bei Naturbeobachtungen tagsüber.
Eine Umkehrlinse oder ein Amici-Prisma bringen
ein seitenrichtig aufrechtes Bild. Ihr Einsatz ist vom
Teleskoptyp abhängig und bringt - vor allem bei
preisgünstigen Modellen - Qualitätsverluste. Amici-Prismen
zum günstigen Preis können für den Einstieg in die
Astronomie hilfreich sein, wenn auch der Sucher ein
korrektes Bild liefert. So hat man zwei identische Bilder.
Später kann man auf sie verzichten oder sollte mehr
investieren, um den Brillanzverlust gering zu halten.
Ich kann nur dazu raten, im ersten Jahr (falls nicht
gerade die Sonne im Fokus stehen soll) noch keine Filter
zu kaufen, in der Regel sind die Erwartungen an Filter
viel zu hoch und es kommt zügig zu Frustrationen. Zum
Einstieg empfehlen sich drei Filter besonders. Zunächst
ein Mond- oder Polarisationsfilter zur Abmilderung
grellen, detailstörenden Lichtes bei der Betrachtung des
Mondes oder heller Planeten, dann ein UHC-Filter
für die Betrachtung leicht zugänglicher Nebel wie etwa des
Orion-Nebels M42 (ein geeignetes Objekt für den Einstieg
in die Filternutzung) und vielleicht auch noch ein Rot-
oder Orangefilter für die Tagbetrachtung etwa der Venus.
UHC-Filter eignen sich auch für den schon mit dem Glas gut
- aber selten - zu sehenden Lagunennebel M8, den
Adlernebel M16, den Omeganebel M17, den gleichfalls dem
Glas gut zugänglichen Großen Hantelnebel M27 sowie
Rosetten- und Eskimonebel.
Wer schon sicherer ist im Auffinden besonders lichtschwacher Nebel und an diesen interessiert, der wird sich zum UHC-Filter bald noch einen OIII-Filter anschaffen, der allerdings die Sterne dann noch stärker wegfiltert. Er erfreut uns - wenn die Umstände günstig sind - etwa beim Kleinen Hantelnebel M76, beim Eulennebel M97, beim Cirrusnebel und beim Nordamerikanebel. Bei sehr guten Bedingungen neben UHC auch für Herz- und Seelen-/Babynebel. UHC- und OIII-Filter werden auch "Nebelfilter" genannt. Sie verstärken die Wahrnehmung von Nebeln und filtern (vor allem OIII) auch das Streulicht von Straßenbeleuchtungen etc. weg. Sie verfälschen die Farben und sind daher z.B. für die Planetenfotografie selten geeeignet. Bei hohen Vergrößerungen filtert vor allem der OIII meist zu stark.
Für einige Nebel, so den Pferdekopfnebel und den
Kaliforniennebel, kann sich die Anschaffung eines H-Beta-Filters
lohnen. Auch der Nordamerikanebel zeigt einige besondere
Strukturen damit. Es erfordert jedoch große Leidenschaft,
um zweimal 200 Euro für ein Paar spezieller H-Beta-Filter
1,25 Zoll zu investieren, das den Kaliforniennebel bei
kleiner Vergrößerung dann besonders deutlich als graue
Socke zeigt. Über die graue Socke ist dann allerdings
schon mancher zur Astrofotografie gekommen.Vertiefende
Informationen zum Filtereinsatz gibt es über meine
Literaturseite/Linkseite bei Dave Knisely
(Filtereinsatz en détail), Sven
Wienstein (Nebelfilter) und Christopher Hay
(Filterexperimente).
Bitte keine Wunder von Nebelfiltern erwarten. Wenn wir
ohne Filter nichts sehen, wird auch ein Standardfilter
nichts herbeizaubern. Da hilft nur ein besseres Seeing
oder eine größere Öffnung. Oder, mal wieder, eine
geringere Vergrößerung. In der Betrachtung verstärken die
meisten Filter lediglich den Kontrast, indem sie Licht
wegfiltern, das nicht von den Nebeln kommt. Erst in der
Astrofotografie entfalten sie ihre ganzen Potentiale,
durch Langzeitbelichtung und/oder die Verwendung
unterschiedlicher Filter für dann übereinander gelegte
Aufnahmen.
Für die Sonnenbeobachtung wird ein Sonnenfilter
oder eine preisgünstigere Sonnenfolie benötigt, die vor
die Objektive von Teleskop und Sucher zu montieren sind.
Es gibt auch spezielle Teleskope und Sucher für die
Sonnenbeobachtung. Ungeschützt niemals Teleskop oder
Fernglas auf die Sonne oder auch nur in ihre Nähe richten!
Und Kinder bei Tag nicht unbeaufsichtigt an Teleskope oder
Ferngläser lassen - dieser Gefahr wegen!
4 Himmelsobjekte
Was sind eigentlich die Objekte, die Hobby-Astronomen
betrachten? Einzelne Sterne eher nicht, denn die sind im
Fernglas oder Normalteleskop erstmal langweilig. Jeder
Stern am Nachthimmel ist ein - hellerer oder dunklerer -
Lichtpunkt. Und er bleibt ein Lichtpunkt, der nicht an
Größe zunimmt, wenn ich ihn durchs Teleskop sehe. Eine
Ausnahme gibt es, die Sonne. Sie wird größer im Teleskop,
kann aber aus naheliegenden Gründen nur bei Tag betrachtet
werden, und nur mit speziellen Schutzausrüstungen. Schon
mit einfachen Mitteln lohnende Objekte sind dagegen der
Mond und einige Planeten. Richtig interessant wird es für
die meisten Betrachter erst mit den sogenannten "Deep
Sky"-Objekten (DSO). Sie befinden sich außerhalb unseres
Sonnensystems und sind keine einzelnen Planeten oder
Sterne, sondern Sternhaufen, Nebel oder Galaxien.
Einige DSO, wie die Plejaden oder der Orion-Nebel, gehören zu unserer Galaxie, der "Milchstraße", und sind auch mit dem bloßen Auge bereits zu sehen. Für andere, die "extragalaktischen Objekte", verlassen wir unsere Galaxie. Der Andromeda-Nebel ist die nächstgelegene fremde Galaxie, in 2.2 bis 2.5 Millionen Lichtjahren Entfernung. Er ist gleichfalls schon mit dem bloßen Auge, aber nur als diffuser Lichtfleck zu sehen. Für Details benötigen wir nicht einmal eine besondere Vergrößerung, aber ein lichtstarkes Objektiv - oder eine Langzeitbelichtung in der Astrofotografie. Und damit wird das Hobby schon zur Schlepperei, wenn wir keine fest eingebaute Sternwarte in lichtarmer Gegend unser eigen nennen. Denn bei "Lichtverschmutzung" und Luftturbulenzen durch beheizte (oder tagsüber durch die Sonne aufgeheizte) Gebäude zeigt auch das beste Teleskop nur wenig. Wir müssen also für die Betrachtung von Galaxien in der Regel einen geeigneteren Ort als unseren Wohnsitz aufsuchen.
Das für die Grundorientierung am Nachthimmel relevanteste Objektverzeichnis ist der Messier-Katalog (abgekürzt "M") des französischen Astronomen Charles Messier von 1781 mit 110 Objekten, geordnet nach dem Zeitpunkt ihrer Entdeckung. Er enthält vor allem Galaxien, Sternhaufen und Nebel, die mit den heute im Amateur-Bereich üblichen Ausrüstungen aufgefunden werden können, großteils sogar schon mit dem Fernglas. Im Dezember 1995 veröffentlichte Patrick Caldwell-Moore seinen 109 Objekte umfassenden Katalog für Amateurastronomen (abgekürzt "C" oder "Cal"), weitgehend basierend auf der Liste Messiers. Der Vorzug des Caldwell-Katalogs liegt in seinem systematischen Aufbau nach der Position am Himmel.
245 Sternhaufen (überwiegend) verzeichnet der 1915
veröffentlichte Katalog von Philibert Jacques Melotte
(abgekürzt "Mel"). Der schwedische Astronom Per Collinder
stellte 1931 eine Liste mit 471 Offenen Sternhaufen
zusammen (abgekürzt "Cr" oder "Col").
Ende des 19. Jahrhunderts entstand der New General
Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars (NGC) mit 7840
Einträgen. Er wurde 2009 grundlegend überarbeitet und gilt
noch heute als das maßgebliche Standardwerk. Gelegentlich
tauchen auch für Amateurastronomen andere Spezial-Kataloge
auf, so vor allem der Index-Katalog ("IC"), angelegt als
Erweiterung des NGC.
4.1 Sonne
Mit Astronomie verbinden die meisten die dunkle Nacht,
über uns "der bestirnte Himmel". Dabei vergessen wir, der
für uns wichtigste Stern ist die Sonne. Und was wir als
Sterne sehen, sind andere Sonnen, nur weiter weg von uns.
Schon unsere eigene Galaxie, die Milchstraße, hat nach
aktuellen Schätzungen zwischen 100 und 400 Milliarden
Sonnen/Sterne, die wir nur als Lichtpunkte oder
Nebelstrukturen sehen. Aber sollte es in fernen
Sonnensystemen intelligente Wesen mit Teleskopen geben, so
sehen sie unsere Sonne ebenso wie wir die ihre: als
winzigen Lichtpunkt - vielleicht auch nur als einem
diffusen Nebel zugehörig!
Für viele Hobby-Astronomen ist vor allem die Sonne eine
Möglichkeit, das Hobby auch bei Tage auszuüben. Und zu
sehen gibt es dort einiges, Granulationen, Sonnenflecken,
Sonneneruptionen, Sonnenhalos oder auch mal den Merkur
oder die Venus beim Transit, wenn sie gerade vor der Sonne
vorbeiziehen. Anders als die meisten sonstigen
Himmelsobjekte ist die Sonne in beständiger Aktivität zu
beobachten. Auch andere Sterne sind aktiv - aber sie sind
zu weit weg, als dass wir dies studieren könnten.
Wichtig bei der Sonnenbeobachtung ist zum einen der Schutz von Augen und Ausrüstung durch geeignete Filter oder eine Sonnenfolie vor dem Teleskopobjektiv und vor allen Suchern, sofern diese nicht abmontiert oder abgedeckt sind. Auch die Kameraoptik ist ggf. entsprechend zu schützen. Die Augen selbst müssen für die freie Betrachtung hinreichend geschützt sein etwa durch eine Sonnenfinsternis-Brille (die reicht aber nicht als Schutz für den Blick durch das Fernglas oder Teleskop!). Andere Personen dürfen ohne entsprechende Information und entsprechenden Schutz keinen Zugang zum Gerät haben, Kinder sind unbedingt zu beaufsichtigen. Und dann empfiehlt es sich, die Beobachtung im Schatten durchzuführen und bei höherem Sonnenstand, da es sonst zuviele optisch-atmosphärische Störungen gibt.
Zu schützen sind nicht nur die Augen, sondern auch das
Teleskop selbst. Die Sonnenstrahlen können beim
ungefilterten Eindringen durch das Objektiv das
Teleskopinnere schädigen durch Erhitzung. Ein Filter nur
am Okular zum Schutz der Augen ist daher nicht
ausreichend!
4.2 Mond
Den Mann im Mond sucht niemand mehr, auch keine
Mondkälber. Und doch ist der Mond noch liebstes
Beobachtungsobjekt aller Einsteiger. Denn er ist gut
sichtbar, kann bei Tag und bei Nacht und in hellen
Sommernächten beobachtet werden, hat eine faszinierende
Struktur mit seinen Kratern und Ebenen und Gebirgen, die
sich besonders gut bei abnehmendem und zunehmendem Mond am
Helligkeitsrand zeigen. Er beflügelt die Phantasie, bietet
aber auch Platz für ernsthafte Beobachtung. Und wir können
ihn anhand detaillierter Mondkarten ausgiebig studieren.
Jedenfalls die Seite, die er uns beständig zukehrt.
Für die Mondbetrachtung genügt bereits ein einfaches
Fernglas. Und mit lichtstarken Teleskopen ist auf den
ersten Blick nicht mehr zu sehen, sondern weniger - zumal
bei Vollmond. Denn er erscheint dann als gleisende
Lichtscheibe. Was schon manchen Betrachter zunächst an
seiner neuen Ausrüstung zweifeln ließ. Dabei ist es nur
die Überfülle an Licht, die ihn durch eine Teleskopoptik
so abweisend macht. Abhilfe kann ein schlichter Graufilter
bringen. Angeboten werden auch spezielle Mondfilter, die
allerdings in der Regel nichts weiter als Graufilter sind,
es gibt sie mit unterschiedlicher Transmission. Ein
Polarisationsfilter ist flexibler und auch für helle
Planeten einsetzbar, mit variabler Abdunkelung - aber auch
teurer.
Da bei Vollmond andere Himmelsobjekte ohnedies schlecht zu sehen sind wegen seines Streulichtes, bieten sich Vollmondnächte zur Mondbeobachtung an. Und bei Vollmond geht es mit dem Teleskop ohne Filter wirklich nicht, sofern er etwas höher über dem Horizont steht, zumal dem Auge das grelle Licht nicht gut tut. Der Mond eignet sich auch zur Sehschulung, indem Sie Zeichnungen anfertigen von dem, was Sie sehen oder zu sehen meinen. Dann sollten Sie aber mit dem Teleskop, nicht mit Fernglas oder Spektiv, arbeiten, um auch das Sehen durch dessen Optik zu schulen.
Am besten nimmt man sich auch öfter einige Tage innerhalb
eines Mondzyklus Zeit, den Mond in verschiedenen Phasen zu
betrachten. Denn es sind vor allem die Regionen am
Terminator (das ist die Grenze zwischen beleuchteter und
unbeleuchteter Mondfläche), die sich gut studieren lassen,
da sie plastischer hervortreten - unterschiedliche
Regionen bei zunehmendem bzw. abnehmendem Mond. Bei
Vollmond können wir dagegen einen Überblick gewinnen. Und
mit Bewölkung lassen sich zum Vollmond mit dem Fernglas
sehr malerische, bisweilen auch gruselige
Wolkenbeobachtungen machen.
4.3 Planeten
Eine der verblüffendsten Beobachtungen für Einsteiger ist, wenn beim Heranzoomen eines "Sterns" dieser deutlich größer wird und sich als Planet entpuppt. In der Regel ist man darauf vorbereitet, aber die Wirkung ist dennoch beeindruckend. "Echte" Sterne, früher Fixsterne genannt, werden auch mit der höchsten Vergrößerung nicht wahrnehmbar größer - dazu sind sie einfach zu weit von uns entfernt. Nur Sonne, Mond und die Planeten unseres Sonnensystems nehmen an Größe zu, und je näher sie uns stehen, umso markanter.Planeten, früher ihrer signifikanten Eigenbewegungen wegen auch Wandelsterne genannt, gehören zu den beliebtesten Objekten für die Himmelsbeobachtung. Einige offenbaren vor dem Teleskop interessante Besonderheiten wie Monde (Jupiter) oder Ringe (Saturn) und faszinierende Oberflächen. Zudem aktivieren sie reichhaltige kulturgeschichtliche Bezüge durch ihre mythologisch gesättigten Namen, ihre unterschiedlichen Gestalten und ihre astrologischen Bedeutungen.
Unterschieden werden die vier inneren Gesteinsplaneten Merkur, Venus, Erde und Mars von den vier äußeren Gasriesen, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Pluto gehört zu den Objekten des Kuipergürtels und zählt seit 2006 offiziell nicht mehr zu den Planeten, sondern gilt nur noch als "Zwergplanet". Es gibt
 mehrere
Pluto ähnliche Objekte im Kuipergürtel, davon galt Eris
lange als größer denn Pluto, was inzwischen angezweifelt
wird. Die Masse von Eris liegt aber gesichert über der von
Pluto. Auch im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter
gibt es einen interessanten Zwergplaneten, Ceres, 2006
offiziell als solcher (und der nunmehr kleinste) anerkannt.
Bemerkenswert und lehrreich ist, was der Cartoonzeichner
Hannes Richert zur Konkurrenz Pluto-Saturn/Jupiter ausführt
in einem Comicstrip mit dem Titel "Lose Gasscheiße", hier
mit der ersten von drei Zeilen zitiert aus der
Satire-Zeitschrift "Eulenspiegel", Heft 6/2023.
mehrere
Pluto ähnliche Objekte im Kuipergürtel, davon galt Eris
lange als größer denn Pluto, was inzwischen angezweifelt
wird. Die Masse von Eris liegt aber gesichert über der von
Pluto. Auch im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter
gibt es einen interessanten Zwergplaneten, Ceres, 2006
offiziell als solcher (und der nunmehr kleinste) anerkannt.
Bemerkenswert und lehrreich ist, was der Cartoonzeichner
Hannes Richert zur Konkurrenz Pluto-Saturn/Jupiter ausführt
in einem Comicstrip mit dem Titel "Lose Gasscheiße", hier
mit der ersten von drei Zeilen zitiert aus der
Satire-Zeitschrift "Eulenspiegel", Heft 6/2023.Wer Kinder für die Astronomie begeistern möchte, der lasse sie die Jupiter-Monde und die Saturn-Ringe entdecken. Dabei lernen sie auch gleich, dass die Planeten sich anders bewegen als die Sterne. Für eine gute Nachführung sollte gesorgt sein, damit sie nicht gleich enttäuscht werden, wenn das Objekt ständig aus dem Gesichtsfeld verschwindet. Vielleicht wollen sie auch noch Venus und Mars sehen, von denen sie schon gehört oder gelesen haben. Leider sind die beiden mit Hobby-Teleskopen in der Regel nicht sonderlich spektakulär. An Mars lässt sich jedoch die Geduld des Beobachtens üben, denn nach einiger Zeit enthüllt er doch einige Details seiner Oberfläche. Für die Polkappe braucht man schon etwa eine 300fache Vergrößerung, da sollte das Objektiv entsprechend lichtstark sein. Entscheidend für die Detailschärfe der Beobachtungen ist auch die Nähe der Planeten zur Erde, was vor allem bei Jupiter und Saturn erhebliche Unterschiede in der scheinbaren Größe ausmacht. Himmelskalender geben darüber Auskunft, wann wir sie besonders groß wahrnehmen können.
Venus, den Morgen- und Abendstern, kann man auch bei Tage gut anschauen, ein Rotfilter ist dann hilfreich, um die Himmelsbläue abzudunkeln. Was wir von ihr sehen ist allerdings die Wolkendecke um die Venus, nicht ihre Oberfläche. Morgenstern ist die Venus am Osthimmel, Abendstern am Westhimmel - innerhalb eines 19-monatigen Zyklus jeweils etwa 6-7 Monate. Auch der zweite sonnennahe Planet, Merkur, ist bei Tag gut zu sehen, genau genommen nur bei Tag bzw. in der Dämmerung, denn er kreist am sonnennächsten und verschwindet mit der Sonne vom Himmel. Merkur ist ähnlich dem Mond mit Kratern übersät. Viel zu sehen bekommen wir von ihm auch mit hoher Vergrößerung nicht, abgesehen von seiner Sichelform je nach Position zur Sonne.
Uranus wurde 1781 durch Wilhelm Herschel bei einer systematischen Himmelsdurchmusterung entdeckt. Etwas besser als Neptun (entdeckt 1856 nach ausführlichen Berechnungen mit dem Berliner Refraktor Fraunhofers) können wir Uranus mit Teleskopen schon als kleine Scheibe sehen. Uranus erscheint wegen des hohen Methananteils seiner Atmosphäre blau-grün, Neptun mit einem gleichfalls hohen Methangehalt in der Atmosphäre sehen wir in stärkerem Blau, allerdings eher als Lichtpunkt. Methan absorbiert rotes Licht.
4.4 Einzelsterne
Im allgemeinen Diskurs nehmen Sterne eine besondere Rolle ein, etwa in astrologisch geprägten Redewendungen wie "die Sterne stehen günstig". Wobei die Astrologie Sonne, Mond, Sternbilder und Planeten - Planeten als "Wandelsterne" - betrachtet für ihre Prognosen. Wenn wir "nach den Sternen greifen" meinen wir extrem ambitionierte Ziele. Und bei Arthur Clarke, dem bekannten SF-Autor, stehen die Sterne für die Schöpfung in seiner wunderbaren Erzählung "The Nine Billion Names of God". Das Ende der Schöpfung markiert er dort mit dem schlichten Satz: "Overhead, without any fuss, the stars were going out."
Einzelne Sterne stehen nicht im Fokus des üblichen Interesses bei Hobby-Astronomen. Ausnahmen sind Sterne mit einer besonderen Geschichte, auffallender Farbigkeit oder sonstigen Besonderheiten, wie etwa bei Doppel- bis Mehrfachsternen. In ihrer Farbigkeit prägnant sind etwa der bläuliche Riegel (ein Mehrfachsternsystem) und die hellblaue Spica, die gelb-rötliche Beteigeuze, der orangefarbene Aldebaran (das rote Auge des Stiers) oder der gelbliche Pollux. Blau sind die heißesten, rot die kühlsten Sterne.Beteigeuze, international Betelgeuze, Betelgeuse oder Alpha Orionis genannt, hat ihren Namen aus dem Arabischen, er bedeutet "Hand der Riesin". Aufzufinden ist sie leicht als markanter Endpunkt des Sternbildes Orion. Es handelt sich um einen Riesenstern, der in starken Teleskopen nicht nur als Lichtpunkt, sondern als ausgedehnte Scheibe wahrnehmbar ist. Stünde er an Stelle unserer Sonne, würde sein Umfang über die Marsbahn hinausgehen, also Merkur, Venus, Erde und Mars verschlucken. Beteigeuze ist etwa 640 Lichtjahre von uns entfernt, ihre Leuchtkraft ist etwa 60.000 mal größer als die der Sonne, sie variiert allerdings stark in periodischen Abständen. Beteigeuze ist am Ende eines Sternenlebens angekommen und wird in den kommenden 100.000 Jahren in einer Supernova explodieren. Im Dezember 2019 verlor der Stern erheblich an Helligkeit, was als Vorbote der Supernova interpretiert wurde. Die Phase dauerte bis März 2020 und wurde auch von Hobby-Astronomen ausgiebig beobachtet und gedeutet. Inzwischen wird von einer Staubwolke als Ursache der vorübergehenden Verdunkelung ausgegangen. Ein weiterer interessanter roter Riese ist Erakis, Mu Cephei, Herschels "Granatstern", seiner intensiv roten Farbstrahlung wegen so genannt, die teilweise von interstellarem Staub herrührt. Auch schön anzuschauen und einfach zu finden ist U Hya/U Hydrae, ein später/kühler Roter Riese, der seine intensive Rotfärbung Kohlenstoffmolekülen verdankt, die das Blaulicht absorbieren. Mit ihren Rottönen fasziniert auch die leuchstarke La Superba im Sternbild Jagdhunde. Antares verdankt seiner intensiven Rotfärbung die Bezeichnung als "Gegen-Mars" = "Ant-Ares".
Ein moderner Mythos rankt sich vor allem im deutschsprachigen Raum um Wega/Vega, fachsprachlich Alpha Lyrae genannt, im Sternbild der Leier (Lyra). Das verdankt sie einmal der deutschen SF-Romanserie "Perry Rhodan", in welcher Wega ein System von 42 teilweise bewohnten Planeten hat, und zum anderen der amerikanischen SF-Serie "Invaders", deutsch "Invasion von der Wega", die 1967/68 produziert wurde. Im amerikanischen Original kommen die Invasoren allerdings nur "from another galaxy". Wega ist nach Sirius und bisweilen Arktur (variabel) der zweit- bzw. dritthellste Stern am Nordhimmel und wurde 1850 als erster Stern überhaupt auf einer Fotografie festgehalten. In der Astronomie hat er durch seine Zugehörigkeit zum Sternbild Leier und zum Sommerdreieck symbolische Bedeutung. Wega gehört zum Castor-Bewegungshaufen. Das Sternbild Leier/Lyra wird in der griechischen Mythologie verbunden mit dem Instrument des Orpheus, das nach dessen Versagen bei der Hades-Rückkehr zur Strafe an den Himmel gebannt wurde. In der chinesischen Volksliteratur wird Wega mit der Weberin/Prinzessin Zhi Nü identifiziert, die sich in den Kuhhirten Niu Lang (Altair) verliebt, aber durch die Milchstraße auf ewig von ihm getrennt wird. Die Legende vom Kuhirten und der Weberin ist in ganz Südostasien verbreitet und lässt sich bereits um das Jahr 1000 in der chinesischen Literatur nachweisen. Die Geschichte von Hero und Leander aus der griechischen Antike, am Hellespont angesiedelt, könnte auf einen gemeinsamen Ursprung zurückgehen.
4.5 Doppel- und Mehrfachsterne
Über die Hälfte der Sterne unseres Milchstraßensystems sind
Teile von physischen Doppel- oder Mehrfachsystemen. Wobei
die Begriffe "Doppelstern" oder "Doppelsystem" häufig auch
für Mehrfachsysteme verwendet werden, da es sich bei diesen
zumeist um ineinander geschachtelte oder aneinander
gekettete Doppelsysteme handelt oder um Doppelsysteme mit
einem Anhang. Physische Mehrfachsysteme sind gravitativ
aneinander gebundene Sterne mit einem gemeinsamen
Schwerpunkt. Im Unterschied zu Sternen, die nur zufällig
durch optische Überlagerung im Blick von der Erde aus als
Doppel- oder Mehrfachsysteme erscheinen. Nicht alle
physischen Mehrfachsterne können wir auch optisch
wahrnehmen, von vielen wissen wir nur durch Interferenz-
oder Spektralanalyse.Die Phantasie der Menschen wurde durch Doppelsterne - wie durch alle Doppelungen - in besonderer Weise angeregt. Das zeigt sich schon in der Antike mit Kastor und Pollux, dem "Freundespaar", die allerdings kein echtes, physisches, sondern lediglich optisches Paar aus Erdperspektive sind. In der Gegenwart spielt das Motiv in der Science Fiction eine wichtige Rolle, etwa auf Tatooine, der Heimat von Luke Skywalker in "Star Wars". Robert Heinlein interessiert sich in "Double Star" allerdings, anders als die deutsche Übersetzung "Doppelstern" vermuten lässt, nur für die philosophisch-psychologische Idee des Doubles und der Doppelgängerschaft (unter "Stars" im Sinne "bekannte Persönlichkeit") sowie die Spannung zwischen öffentlicher Rolle und Privatheit, Pflicht und Neigung - nicht für astronomische Doppelsterne. Auch Ursula Le Guin entwickelte verschiedentlich das Motiv der doppelten Persönlichkeit, so mit dem Geschlechtsdimorphismus der Winterwelt in "The Left Hand of Darkness" und mit der politischen Ambivalenz des Doppelplaneten Urras/Anarres in "The Dispossessed".
Andrea Ghez, Physiknobelpreisträgerin von 2020 zusammen mit Reinhard Genzel für die Entdeckung des Schwarzen Lochs im Zentrum unserer Milchstraße, erklärte in einem Interview mit dem österreichischen Standard anlässlich der Verleihung, eine ihrer "Lieblingsideen" sei, dass Doppelsterne in der Nähe eines Schwarzen Loches zusammengeführt werden, wobei die riesigen Objekte entstehen, die dort beobachtet werden. Ghez beschäftigte sich schon früh mit Doppelsternen und entwickelte die Infrarotastronomie zur Auflösung von Doppelsternen weiter.
Von ganz eigener Bedeutung unter den Doppelsternen ist Polaris, Alpha Ursae Minoris, der Polarstern oder Nordstern, ein Dreifachstern (Polaris Aa, Ab, B). Er ist der hellste Stern und das Deichselende im Sternbild Kleiner Wagen (Kleiner Bär) und wird bei parallaktischen Montierungen zur Polausrichtung verwendet, da er sich nahe beim Himmelspol befindet. Da er fast exakt im Norden steht und sich kaum (scheinbar) bewegt, vielmehr der gesamte Sternenhimmel sich um ihn zu drehen scheint, wurde er früher häufig zur Orientierung angepeilt, insbesondere in der Seefahrt. Optisch aufzulösen ist er schwer, da B sehr lichtschwach/klein ist und Ab sehr nahe bei Aa liegt.
Ein interessanter und einfach zu beobachtender Doppelstern ist Mizar, der mittlere Stern in der Deichsel des Großen Wagens (Teil des Sternbildes Großer Bär), mit seinem Partner Alkor. Der kleinere Alkor wird auch "Reiterlein" genannt, wegen seines spezifischen Bezuges zu Mizar. Die Entfernung zwischen Mizar und Alkor beträgt etwa 0,3 Lichtjahre. Wie es scheint, haben die beiden ihre Position zueinander im Laufe der Zeit verändert. Spektroskopisch wurde früh festgestellt, dass sie selbst wiederum Doppelsterne sind, allerdings ist das nur bei Mizar auch optisch wahrnehmbar - vollständige Trennung bei etwa 150facher Vergrößerung.
Na'ir al Saif ("Helle des Schwertes") steht im Sternbild Orion, als hellster Stern im Schwert des Jägers. Es handelt sich um einen leicht trennbaren Doppelstern. Die hellere Komponente ist ein extrem heißer O9III-Stern, entsprechend bläulich schimmernd, mit mag 2.77 und 12.600facher Sonnenleuchtstärke. Sein bei 150facher Vergrößerung optisch vollständig abgelöster Partner ist ein A-Riese, mag 6.9. Direkt neben Na'ir al Saif liegt der Doppelstern HIP26199/26197, dessen Trennung schon bei 20facher Vergrößerung beginnt. Noch rascher löst sich der Doppelstern Albireo, Kopfstern des Schwans, auf: Bereits bei 10facher Vergrößerung beginnt, allerdings sehr zögerlich, die Trennung.
Von besonderem Reiz ist auch Achird im einfach aufzufindenden, markanten Sternbild Kassiopeia, dem "Himmels-W" (Altphilologen sehen eher ein großes Sigma). Achird/Eta Cassiopeiae liegt nur 19 Lichtjahre von uns entfernt, ein netter Nachbar also. Er ist rasch zu trennen in einen gelben, sonnenähnlichen Stern mag 3.4 und einen wesentlich kleineren orangefarbenen Begleiter mag 7.5. Benötigt wird eine 50fache Vergrößerung, die Trennung beginnt allerdings mit guten Augen bereits bei 12fach. Mit 20facher Vergrößerung zumindest anfänglich aufzulösen sind - unter zahlreichen anderen - 57 Aquilae, Iota Bootis, SZ Camelopardalis (in einem schönen Offenen Sternhaufen), Alpha Capricorni.
Ein weiterer bekannter Doppelstern ist Kastor, der selbst mit Pollux das berühmteste (allerdings nur scheinbare, nicht physische) Stern-Paar bildet, welches besungen wurde von Schubert in seinem "Lied eines Schiffers an die Dioskuren". Kastor A mit 1.6 mag wird begleitet vom etwas kleineren Kastor B mit 3 mag. Sie sind erst ab 200facher Vergrößerung anfänglich zu trennen, vollständige Lösung bei etwa 700fach. Spektroskopisch zeigt sich Kastor als System aus drei einander umkreisenden Paaren. Aufgepasst: schon bei etwa 12facher Vergrößerung löst sich ein lediglich optischer kleiner Pseudo-Partner, TYC2453-1918-1. Sehr schön ist auch Algieba im Löwen, die Trennung beginnt gleichfalls erst bei etwa 200facher Vergrößerung.
Ein doppelter Doppelstern ist - wie der Name schon verrät - "Double Double" im Sternbild Leier, bestehend aus Epsilon Lyrae 1 und 2. Das physische Paar Double Double ist leicht aufzufinden, enthüllt sich allerdings erst bei Vergrößerungen ab 100fach als Paar aus zwei Sternpaaren.
Häufig genannt wird auch der lichtstarke Doppelstern Capella/Alpha Aurigae im Sternbild Auriga/Fuhrmann, eigentlich ein System aus zwei Paaren, das aber nur mit sehr starken Instrumenten bzw. Interferometrie aufzulösen ist. Hier müssen wir uns mit dem Wissen begnügen. Auch ein anderer berühmter Doppelstern, Sirius, der Hundsstern, ist für Amateurastronomen in der Regel keine Freude, da sein Partner extrem klein/lichtschwach ist.
Wer nicht genug kriegen kann von Doppelsternen, der wird fündig im umfassenden, knapp und kompetent informierenden Verzeichnis "Die besten (3584) Beobachtungsobjekte am nördlichen Himmel für Amateurastronomen" von Georg Henneges.
4.6 Offene Sternhaufen
Erstaunlich ist es schon, welche Faszination eine Zusammenballung von Sternen auf uns ausübt. Ist es die Konzentration von Lichtern, was uns anzieht? Oder verbinden wir damit Werte wie Nähe und Geborgenheit in der Gruppe? Sind es archaische Anklänge, die uns berühren, gewachsen in zahllosen Menschheitsnächten, verbracht unter dem Sternenhimmel über Jahrhunderttausende, mit kaum einem anderen Licht in der Nacht als dem der Koch- und Hütefeuer? "Offene Sternhaufe" sind physikalisch-gravitativ miteinander
verbundene Sterne unterschiedlichen Alters. Die Größe
variiert zwischen etwa hundert und einigen tausend Sternen.
Auch im durchschnittlichen Sternalter gibt es Unterschiede
und dann in der Entfernung von uns - wobei alle der
Amateurastronomie zugänglichen Offenen Haufen in unserer
Galaxie liegen. Der optische Eindruck für uns ist
entsprechend extrem unterschiedliche, von weit entfernten
Sternhaufen wie dem Wild Duck Cluster, den wir im 15x70-Glas
nur als kleinen Wattebausch sehen bis hin zu differenziert
wahrnehmbaren Sternhaufen, die über das Gesichtsfeld unseres
Glases hinausreichen.
"Offene Sternhaufe" sind physikalisch-gravitativ miteinander
verbundene Sterne unterschiedlichen Alters. Die Größe
variiert zwischen etwa hundert und einigen tausend Sternen.
Auch im durchschnittlichen Sternalter gibt es Unterschiede
und dann in der Entfernung von uns - wobei alle der
Amateurastronomie zugänglichen Offenen Haufen in unserer
Galaxie liegen. Der optische Eindruck für uns ist
entsprechend extrem unterschiedliche, von weit entfernten
Sternhaufen wie dem Wild Duck Cluster, den wir im 15x70-Glas
nur als kleinen Wattebausch sehen bis hin zu differenziert
wahrnehmbaren Sternhaufen, die über das Gesichtsfeld unseres
Glases hinausreichen.Besonders markante Exemplare wie die Plejaden (M45 - s. Abbildung links) und die Hyaden (Mel25, C41) haben die Phantasie der Menschheit schon früh beschäftigt und zu mythologischen Deutungen geführt. Für die Tuareg waren Sterne zur Orientierung in der Wüste überlebenswichtig. Die Plejaden waren bei ihnen die sieben Töchter der Nacht, die Winter und Sommer verkünden. Wie der österreichische Literaturwissenschaftler und Romanautor Raoul Schrott uns berichtet, gibt es dazu den Mythos von Kukayod, der seine Schafe, die Sterne der Hyaden, zu den Töchtern der Nacht treibt, um dort seine Frau zu finden - aber nie dort ankommt. In der Antike wurden die Plejaden auch als Atlantiden oder Sieben Schwestern (Töchter von Atlas und Pleione) bezeichnet. Die bislang älteste Darstellung der Plejaden finden wir in der Höhle von Lascaux, vor 20.000 Jahren. Danach kennen wir aus der Bronzezeit ihre Darstellung auf der Himmelsscheibe von Nebra, die etwa 3.600 Jahre alt ist. Im Japanischen werden die Plejaden als "Subaru" ("Zusammenfügung") bezeichnet, sie finden sich im Emblem der gleichnamigen Automarke.
Die Hyaden (von griechisch "hyetos" für Regen), die Regensterne, erscheinen im Herbst, mit den beginnenden Herbstregenfällen. Sie wurden von den Römern "Succulae", Ferkelchen genannt, die sich um die Muttersau, den Stern Aldebaran scharen. "Aldebaran" kommt aus dem Arabischen und bedeutet: der Nachkommende, da er die Plejaden zu verfolgen scheint. Womit der Bogen zu Kukayod und seinen Schafen geschlagen wäre. Aldebaran gehört allerdings physikalisch nicht zu den Hyaden.
Ein unter Himmelsbetrachtern gleichfalls beliebter offener Sternhaufen ist der Bienenstock-Haufen (M44), in der Antike Praesepe/Futterkrippe genannt, im Sternbild Krebs. Wir finden ihn in der Nähe von Pollux. Er hat einen ähnlichen Charakter wie die Plejaden, ist allerdings lichtschwächer. Schon bei leichter Cirrusbewölkung verschwindet er, weshalb er früher (ex negativo) zur Wetterprognose genutzt wurde. In der griechischen Mythologie diente der Sternhaufen, seitlich zwischen Asellus Australis und Asellus Borealis gelegen, diesen "Eseln" (nichts anderes bedeutet "Asellus") des Dionysos als Futterkrippe bei einer der Irrfahrten ihres Herrn.
Die bekanntesten offenen Sternhaufen sind ihrer Nähe zu uns wegen schon für das bloße Auge auffallend und mit dem Fernglas schön aufgelöst zu sehen, so die Hyaden (150 Lichtjahre), der Coma-Berenices-Haufen (260 Lichtjahre), die Plejaden (395 Lichtjahre), die Perseus-Gruppe/Alpha Persei-Gruppe/Melotte 20 (560 Lichtjahre) und Beehive/Bienenstock (565 Lichtjahre). Weitere lohnende Haufen für sehr starke Ferngläser oder das Teleskop sind etwa der Schmetterlingshaufen in 1.600 Lichtjahren, der Weihnachtsbaum-Haufen in 2.500 Lichtjahren und der Wildenten-Sternhaufen mit über 3.000 Mitgliedern in 6.100 Lichtjahren Entfernung. Selbst der 9.000 Lichtjahre von uns entfernte Eulen-Haufen mit lediglich etwa 80 - aber kräftigen - Sternen ist schon mit dem 20x80-Glas differenziert auszumachen. Wie ein kleines Gespenst schwebt es im All, für mich ist es "s'Geischdle", der kleine Geist, eines meiner liebsten Objekte.
Ein bemerkenswertes, leicht aufzuspürendes Objekt ist der in unserer Milchstraße einzigartige Doppelsternhaufen Ha-Chi-Persei in 6.800 bzw. 7.600 Lichtjahren Entfernung mit über 600 Sternen in weißblauen und orangenen Farbtönen. Er war bereits dem bedeutenden griechischen Astronomen Hipparchos von Nicäa (etwa 190-125 v. Chr.) bekannt. Wir finden ihn als Spitze in einem Dreieck mit Mirfak und Almach.
4.7 Kugelsternhaufen
Strenger gefasst als die offenen Sternhaufen erscheinen am
Himmel die zahlreichen Kugelsternhaufen, deren Teilnehmer
gemeinsam zu Beginn unseres Universums entstanden sind
(während es in den weit jüngeren Offenen Haufen ältere und
jüngere Sterne gibt). Sie sind stets einer Galaxie
zugeordnet und befinden sich im Halo dieser Galaxie. Unsere
Milchstraße birgt in ihrem Halo ca. 200-500 Kugelsternhaufen
- die Riesengalaxie M87 hat davon 12.000-16.000. Die Anzahl
der Sterne eines Kugelhaufens liegt weit über der in Offenen
Sternhaufen und reicht von 10.000 bis zu einigen Millionen
Sternen. Die galaktischen Kugelsternhaufen geben sehr
dankbare Beobachtungsobjekte ab, da sie 1. großteils bereits
mit einfachem Gerät wie Ferngläsern aufzuspüren sind, da 2.
einige sich mit stärkerem Gerät gut auflösen lassen und
damit Erfolgserlebnisse vermitteln, da sie 3. eine
interessante Vielfalt bei schlichter Grundform aufweisen.
Kugelsternhaufen sind etwas wie die Bullaugen im kosmischen
Schiff unserer Milchstraße, die den Blick aufs Meer
freigeben.Relativ einfach aufzufinden und für Anfänger geeignet sind die Kugelhaufen M3 im Sternbild Jagdhunde und ganz in der Nähe M13 im Sternbild Herkules. Leider stehen die beiden oft sehr nahe am Zenit. M3 ist 34.000 Lichtjahre entfernt und vor allem im Mai gut zu betrachten, allerdings gelingt erst ab 8''/200mm Öffnung die Auflösung in einzelne Sterne. Der Haufen liegt zwischen Arktur und Cor Caroli, bei HD119081 am Ende der Reihe HD120476 bis HD119081, die prägnant ist durch das Paar HD120007/HD119944. M13 liegt etwa 24.000 Lichtjahre von uns entfernt, leuchtet sehr hell und umfasst wie M3 mehr als 500.000 Sterne. Er liegt zwischen Zeta Herculis (ein Mehrfachsternsystem) und Eta Herculis. M13 ist die Heimat der Arkoniden bei Perry Rhodan.
Eine ganze Kette dem stärkeren Fernglas zugänglicher Kugelsternhaufen erstreckt sich über die Sternbilder Schütze und Skorpion, zwischen dem bläulichen Nunki und der weißen Dschubba. Leider stehen sie nur im Hochsommer weit genug über dem Horizont für die Betrachtung in unseren Breiten. Von Ost nach West sind die für uns wichtigsten M55, M22, M28, M62, M19, M4 und M80. Auf Anhieb zu sehen - bei günstigen Bedingungen schon mit bloßem Auge als diffuser Lichtpunkt - ist M22, ähnlich beeindruckend wie M13. Der Nachbar von M55, M54, ist einer der wenigen relativ einfach beobachtbaren Kugelsternhaufen, die nicht zu unserer Galaxie gehören (was erst 1994 erkannt wurde). Er ist mit 87.400 Lichtjahren fünfmal so weit von uns entfernt wie M55, aufgrund seiner Größe (200 Lj Ausdehnung) und seiner absoluten Helligkeit (-9,54 mag) mit der VM von +7.59 jedoch noch mit einem starken Fernglas bei günstigen Bedingungen gut zu erfassen.
Oberhalb von Skorpion finden wir sommers im Sternbild Schlangenträger/Ophiuchus eine fast parallele, einfach zugängliche und interessante kürzere Kugelhaufenkette aus M14, M10, M12 und M5. M10 und M12 sind einander unmittelbar benachbart und erfreuen durch den Kontrast ihrer Farbigkeit, silbrig der eine, golden der andere - was leider im Fernglas nur bei wirklich dunklem Himmel zu sehen ist. Zur Orientierung hilft uns das gelb-rötliche Yed-Sternpaar, die linke Hand des Schlangenträgers aus Yed Prior und Yed Posterior ("Yad" ist Persisch für "Hand"). In mittlerer Höhe steht im Sommerhalbjahr an der Nase von Pegasus ein weiterer dem Fernglas gut zugänglicher Kugelhaufen, M15, aufzuspüren in einem Dreieck mit Enif und Delta Equulei. Darunter liegt der gleichfalls ansehnliche Kugelhaufen M2 im Sternbild Wassermann.
Kugelsternhaufen eignen sich vorzüglich, das Auffinden von "Wattebäuschen" (Sternhaufen, Galaxien, Nebel) einzuüben! Es gibt davon zahlreiche gut bekannte, einfach aufzufindende Exemplare.
4.8 Planetarische Nebel
Für Charles Messier gab es 1781 noch keine Galaxien und Kugelsternhaufen. Er sah nur helle Nebelflecken, die er katalogisierte, um sie nicht mit Kometen zu verwechseln, und einige offene Sternhaufen. Später lösten sich viele seiner "Nebel" in offene Sternhaufen, in Kugelhaufen und Galaxien auf. Der Andromeda-Nebel heißt auch heute noch oft so, obgleich es sich korrekt um eine Galaxie handelt.Die begriffliche Differenzierung von "echten" Nebeln ist nicht immer klar und wird unterschiedlich gehandhabt. Galaktische Nebel (was eigentlich nur den Ort, innerhalb unserer Galaxie nämlich, benennt) heißen in der Regel alle Nebel unserer Milchstraße, oft werden damit aber auch nur die nicht-planetarischen Nebel benannt. An den Galaktischen Nebeln wird im Regelfall unterschieden in Planetarische Nebel, Emissionsnebel und Reflexionsnebel. Planetarische Nebel heißen so wegen ihrer rundlichen Form, die beim Blick durch schwaches historisches Gerät an Gasplaneten denken ließ. Emissionsnebel emittieren selbst Licht, während Reflexionsnebel nur das Licht naher Energiequellen reflektieren. Da Planetarische Nebel formal auch Emissionsnebel sind, finden wir gelegentlich auch nur die primäre Unterscheidung in Emissions- und Reflexionsnebel, und erst danach die in Planetarische Nebel und Supernova-Überreste. Für Hobby-Astronomen ist die Unterscheidung in Planetarische und sonstige Nebel praktisch. Von nicht-planetarischen Emissionsnebeln sehen wir zu Beginn vor allem eine Anhäufung von Sternen, da sie Sternentstehungsgebiete sind. Gebräuchlich ist auch die etwas grobe Unterscheidung in Gasnebel versus Planetarische Nebel, da planetarische Nebel einen markanten Kern haben.
Nach dem optischen Eindruck können wir die kompakt umrissenen Planetarischen Nebel, die sich auch ohne Filter im Teleskop gut zeigen (wenn überhaupt), unterscheiden von den großflächigen, zerrissenen Reflexions- und Supernova-Emissions-Nebeln. Wobei einige Supernova-Reste optisch den Planetarischen Nebeln nahe kommen. Für Einsteiger sind zunächst vor allem Planetarische Nebel wie der Hantel- oder der Helixnebel (gut nur im Herbst zu sehen) geeignete Aufsuchobjekte. Sie können zugleich stehen für zwei Grundformen der Planetarischen Nebel, die Ringform, wie im Helixnebel, und die Sanduhrform, wie im Hantelnebel.
Aber eines müssen Anfänger sich vor den ersten Enttäuschungen klar machen: Mit den schönen bunten Fotos aus Magazinen und Foren hat der Anblick, der sie erwartet, nichts zu tun! Was wir im Fernglas und auch im Teleskop sehen, ist überwiegend grau und unscheinbar, sofern wir überhaupt etwas sehen können! Die Farben und auch präzise Formen entstehen erst bei Langzeitbelichtungen, Arbeiten mit verschiedenen Filtern, Stacking und Bildbearbeitung - also in der Astrofotografie.
Im Sternbild Fuchs/Füchslein liegt der Hantelnebel (M27, NGC 6853), einer der hellsten Planetarischen Nebel (VM +7.09) in etwa 1.400 Lichtjahren Entfernung, entdeckt 1764 von Messier. Er besteht aus zwei sich überlappenden Nebelstrukturen in der Gestalt einer Hantel, manche beschreiben ihn auch als Fledermaus. Sein Zentralstern ist ein Weißer Zwerg. Er ist auch mit schwächeren Teleskopen gut zu sehen. M27 liegt halbwegs zwischen Albireo und dem Sternbild Delphin.
Ein weiteres interessantes Nebelobjekt ist der "Blinkende Nebel" mit der Katalognummer NGC 6826, im Sternbild Schwan, ein Planetarischer Nebel in einer Entfernung von etwa 2.200 Lichtjahren. Er blinkt nicht wirklich, vielmehr entsteht dieser Eindruck, wenn das Auge zwischen Fokussierung und Vorbeiblick wechselt. Bei lichtstarken Objektiven geht dieser Eindruck verloren. Blinkend ist er mit 8''-Teleskopen sicher wahrzunehmen, ich hab ihn auch schon mit 5'' identifiziert bei 38facher Vergrößerung - dank GoTo.
Und wenn wir dann zur Wega weitergehen, liegt etwas östlich, zwischen Sulafat und Sheliak, im Sternbild Leier/Lyra, der famose Ringnebel M57 (NGC 6720), der gleichfalls auf der Beobachtungsliste von Einsteigern ganz oben steht, auch mit Fernglas, ein Planetarischer Nebel in ca. 2.300 Lichtjahren Entfernung, entstanden vor ca. 20.000 Jahren. Allerdings braucht er eine Vergrößerung ab 80fach - und ein entsprechend lichtstarkes Objektiv. Wirklich famos wird er erst mit Astrofotografie.
Auf der anderen Seite des Schwans liegt im Sternbild Wassermann der Helixnebel, mit einer VM von +7.59 gleichfalls ein Kandidat für das Fernglas. Er erfreut wie der Ringnebel mit einer früh erkennbaren Ringstruktur. Seine Position ist im linken Wassermann-Bein, markiert durch die Sterne Upsilon Aquarii und 47 Aquarii, beide gelblich leuchtend. Leider kommt er nur im Herbst weit genug über den Horizont.
Südlich bis östlich vom Himmels-W Kassiopeia finden wir den Kleinen Hantelnebel, M76. Er ist mit +10.1 mag wesentlich dunkler als sein großer Bruder und dem Fernglas schwer zugänglich. Seine Position ist allerdings durch verschiedene farbige Sterne gut aufzufinden, in der Nähe des gelben Upsilon Persei im Sternbild Perseus unmittelbar neben dem rötlichen HD 10498. Er ist besonders interessant durch die beiden einander entgegengesetzten Ausblühungen an seinen Enden, die ihm eine leichte S-Form geben.
Am Herbsthimmel zeigt sich im wenig bekannten Sternbild Walfisch der Schädelnebel/Scull nebula NGC 2392, der schon im Fernglas als graue Scheibe auszumachen ist, vorzugsweise mit UHC-Filter, da sein Bild mit +10.4 mag eher lichtschwach zu uns kommt. Im Winterhalbjahr können wir uns dann noch auf die Suche nach dem Eskimonebel (NGC 2392, +9.2 mag) im Sternbild Zwillinge machen.
4.9 Nicht-planetarische Nebel
Erste "nicht-planetarische" Nebelerfahrungen machen die
meisten Anfänger mit dem Orion-Nebel (M42, NGC 1976), einem
Emissionsnebel im gleichnamigen Sternbild, der schon mit dem
bloßen Auge bei günstigen Bedingungen im Winterhalbjahr gut
sichtbar ist. Er liegt direkt oberhalb von Na'ir al Saif
("Helle des Schwertes" - leicht trennbarer Doppelstern)
unterhalb des Orion-Gürtels, und ist Teil des
Orion-Schwertes. Seine reichhaltige Struktur offenbart
dieser Nebel bei günstigem Seeing mit einem UHC- oder
OIII-Filter. Die rote Farbe zeigt sich erst fotografisch bei
Langzeitbelichtung.Eine beeindruckende Form hat ganz in der Nähe liegend der 3 Lichtjahre ausgedehnte Pferdekopfnebel (IC 434) aus kaltem Gas und Staub, beim untersten (linken, östlichen) Stern des Orion-Gürtels, Alnitak - einem Dreifachstern. Allerdings löst sich die Pferdekopfform zunehmend auf. Die Form zeichnet sich als dunkle Silhouette vor einem rötlichen Emissionsnebel ab. IC 434 ist etwa 1.500 Lichtjahre von der Erde entfernt.
Etwas weiter entfernt von Orion liegt der Krebsnebel (M1) im Sternbild Stier. Es handelt sich um den Überrest einer gigantischen Supernova, vermutlich durch Elektroneneinfang ausgelöst. Trotz 6.300 Lichtjahren Entfernung wurde diese Supernova am 4. Juli 1054 von chinesischen Astronomen beobachtet und blieb über Wochen am Himmel sichtbar. Im Zentrum des Nebels sitzt ein Neutronenstern/Pulsar mit ca. 30 Kilometern Ausdehnung.
Im Sternbild Perseus finden wir den Kaliforniennebel (NGC 1499), unweit von Xi Per/Menkib. Dieser sehr markante Emissionsnebel erinnert mit seiner länglichen Form manche an den US-Bundesstaat Kalifornien. Mit 1.000 Lichtjahren ist er recht nahe bei uns. Es empfiehlt sich ein Objektiv bis maximal 200mm Öffnung, kurze Brennweite des Tubus und ein Weitwinkelokular mit hoher Brennweite - sonst wird das Bildfeld zu eng und der bildliche Eindruck geht verloren. Als Filter ist wie für den Pferdekopfnebel H-Beta optimal, OIII tuts auch, wenn die Öffnung nicht zu klein ist.
Im Sternbild Schwan breitet sich bei der linken/südlichen Schwinge der Cirrusnebel aus (dessen Teilen verschiedene Katalognummern zugewiesen wurden: NGC 6960, 6974, 6979, 6992 und 6995). Er ist eine Ansammlung von Emissions- und Reflexionsnebeln. Der gesamte Cirrusbogen, von dem wir nur den Cirrusnebel sehen können, ist Überrest einer zwischen 5.000 und 18.000 Jahre zurückliegenden Supernova. Das Objekt ist zwischen 1.400 und 2.600 Lichtjahre von uns entfernt. Irgendwann in der Steinzeit werden also unsere Vorfahren diese Supernova beobachtet haben. Ab 100mm Objektivdurchmesser sind mit einem OIII-Filter bereits Strukturen zu erkennen. NGC 6995, der Fledermausnebel, zeigt sich als erster deutlich als auffallender Langbogen.
Nahe beim Hantelnebel, aber weiter südlich liegen mit M8 (Lagunen-Nebel), M16 (Adler-Nebel) und M17 (Omega-Nebel) drei lichtstarke und gut umrissene Nebelformationen zwischen Schild/Scutum und Schütze/Sagittarius als lohnende Sommer-Objekte. Sie sind auch mit dem Fernglas gut auszumachen. Ausschau kann man dann auch gleich nach dem Trifid-Nebel beim besonders markanten Lagunen-Nebel halten, nach dem Schützen-Sternhaufen und nach dem gut sichtbaren Kugelhaufen M22 (VM +5.09) bei dem orangefarbenen Stern Kaus Borealis/Lambda Sagittarii.
Die zerrissenen, diffusen, geheinnisvollen Nebel haben eine ganz eigene Faszination: Sie künden vom Anfang, vielleicht auch vom Ende des uns - bislang - bekannten Kosmos. "Denn Staub bist du, zu Staub musst du zurück." Der Satz aus Genesis 3,19 war für den Menschen gedacht, aber gilt er nicht auch für die Geschichte unseres Kosmos, die aller seiner Gebilde?
4.10 Galaxien
"Galaxis" ist das griechische Wort für "Milch". Ursprünglich bezeichnete es nur unsere Galaxie (die "Milchstraße"), deren uns sichtbarer Teil nach antiken Vorstellungen von den Göttern an den Himmel geschüttet wurde, als "Milch". Später wurde die Bezeichnung im übertragenen Sinne auch für andere Galaxien verwendet.Eine besonders interessante Galaxie für die Astronomie ist die Große Magellansche Wolke (GMW), eine Zwerggalaxie, die nur 160.000 Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt ist und wie die ihr benachbarte Kleinen Magellanschen Wolke als "Satellitengalaxie" der Milchstraße gilt. Beide Galaxien sind vermutlich mit der Milchstraße gravitativ verbunden und nähern sich ihr. Entdeckt wurden die beiden Galaxien als "helle Wolken" durch Ferdinand Magellan und seinen Reisebegleiter Antonio Pigafetta auf der Westindien-Expedition 1519. Doch bereits in den Mythen der Aborigines von Australien spielen sie eine Rolle. Von der Nordhalbkugel aus sind sie leider nicht sichtbar, nur südlich des 20. Breitengrades.
Die GMW liegt zwischen den Sternbildern Tafelberg und Schwertfisch. Sie bietet alles, was wir auch von unserer Galaxie her kennen, Kugelhaufen, planetarische Nebel, Überreste von Supernovas. In ihr wurde am 23. Februar 1987 eine Supernova entdeckt, die über Monate hinweg sichtbar blieb und detailliert astronomisch analysiert wurde. Aus Untersuchungen der GMW werden auch grundlegende Aufschlüsse über Schwarze Löcher erwartet. Die KMW im Sternbild Kleine Wasserschlange bietet auch Interessantes. Nach neueren Untersuchungen von 2025 dreht sie sich nicht, sondern wird entlang zweier Achsen auseinander gezogen.
Die nächstgelegene und zuerst als solche identifizierte "fremde" Galaxie ist die Andromeda-Galaxie (M31) am Rand des Sternbildes Andromeda in 2.2 bis 2.5 Millionen Lichtjahren Entfernung. Am 30. Dezember 1924 verkündete Edwin Hubbel, dass sie kein Nebel, sondern eine andere Galaxie sei. Sie ähnelt unserer Milchstraße und ist vermutlich die am besten untersuchte Galaxie. Wir können sie unter günstigen Sehbedingungen am Nordhimmel auch mit bloßem Auge wahrnehmen, im Zentrum des Dreiecks Almach-Alpherats-Shedar. Sky Guide gibt eine nützliche Hilfe durch die Andromeda-Linie Mirach-My And-Ny And, an deren Ende (Ny And) wir auch bei ungünstigen Bedingungen mit dem Fernglas die Spiralgalaxie finden können. Schon mit kleineren Teleskopen werden Details erkennbar.
In etwa 2.7 Millionen Lichtjahren Entfernung befindet sich in der südlichen Nachbarschaft die mit dem bloßen Auge kaum zu sehende, aber gleichfalls gut beobachtbare Dreiecksgalaxie (M33), nordöstlich des Sternbilds Dreieck/Triangulum. Sie liegt gut auffindbar von Mirach ausgehend Richtung Metallah in einer "Kiste" aus HR 503, HD 8909, HD 9224 und HR 485. M33 wird gelegentlich auch Pinwheel (Windrad, Feuerrad) Galaxy genannt, eine Bezeichnung, die noch andere Galaxien tragen (z.B. M36, M99, M101). Ihre Größe (AS) ist in einem lichtstarken Glas schier erschreckend, ein riesiger Fleck von annähernd der Ausdehnung der Andromeda, allerdings rund, mit flacher Spiralstruktur, nicht länglich zu sehen, und weitaus lichtschwächer.
IC 342, die Versteckte Galaxie/Hidden Galaxy, ist nur 11 Millionen Lichtjahre von uns entfernt und wäre dank ihrer Ausdehnung und charakteristischen Form eigentlich ein geeignetes Ziel gerade für Einsteiger mit bescheidener Ausrüstung. Doch sie liegt hinter der Lichterfülle im Sternbild Giraffe optisch verborgen für die direkte Betrachtung, da unsere Augen sich dem hellen Vordergrund anpassen. Zu sehen ist im Glas vor allem ihr heller Kern.
Der Bode-Nebel (M81) wurde 1775 von Johann Elert Bode, einem preußischen Astronomen, entdeckt und nach diesem benannt. Dieser "Nebel" ist die Hauptgalaxie einer Ansammlung von mindestens zehn Galaxien in ungefähr 12 Millionen Lichtjahren Entfernung. Zu dieser Ansammlung gehört auch die Zigarren-Galaxie (M82) - von Bode zusammen mit M81 entdeckt. Beide Galaxien liegen im Sternbild des Großen Bären. Im Frühling stehen sie hoch am Himmel und sind gut aufzuspüren. Die längliche Zigarren-Galaxie ist mit schwächerem Gerät das lohnendere Objekt, da von M81 dann nur ein Lichtpunkt zu sehen ist.
In 21 Millionen Lichtjahren Entfernung liegt oberhalb der Deichsel des Großen Wagens die spektakulär ausgebreitete Pinwheel-Galaxie (M101). In ihr ereignete sich am 24. August 2011 eine Supernova. Etwa 28 Millionen Lichtjahre ist die Whirlpool Galaxie (M51) von uns entfernt, die im Sternbild Jagdhunde unterhalb der Deichsel des Großen Wagens liegt. An ihr wurde die Spiralstruktur von Galaxien entdeckt. Sie ist eng verbunden mit der kleineren NGC 5195. Die beiden sind durch ein 200mm-Objektiv (8'') mit klarer Struktur zu sehen. Unweit davon liegt M106 (NGC 4258), eine Balken-Spiralgalaxie, etwa 24 Millionen Lichtjahre entfernt, mit extrem intensiver Röntgenstrahlung.
Etwa 32 Millionen Lichtjahre Distanz zu uns haben M65 und M66, zwei Spiralgalaxien, die zusammen mit der seitlich in Linsenform zu sehenden Spiralgalaxie NGC 3628 (etwa 34 Millionen Lichtjahre entfernt) das Leo-Triplett bilden, das schon mit einem 5-Zöller ordentlich wahrzunehmen ist bei dunklem Himmel, vor allem M66.
Schönes Beispiel einer elliptischen Galaxie, einer Altgalaxie mit gleichmäßiger Lichtverteilung in der kaum mehr Sterne neu entstehen, ist die Riesengalaxie M87/Virgo A in 55 Millionen Lichtjahren Entfernung, im Virgo-Galaxienhaufen. Sie enthält in ihrem Zentrum ein berühmt gewordenes Schwarzes Loch, dessen Strahlenkranz bescherte uns 2019 die erste Aufnahme dieses Phänomens mit dem Event Horizon Teleskop-Verbund. Die gleichmäßig gerundete Form (im Unterschied zu den Spiralgalaxien) ist im 8-Zöller bereits zu erkennen.
In mehr als einer Milliarde Lichtjahren Entfernung liegt im Sternbild Jungfrau, nahe bei Arktur, die größte bekannte Galaxie, IC1101, mit einem Durchmesser von 6 Millionen Lichtjahren. Sie gehört zum Galaxienhaufen Abell 2029. Einen Schimmer von ihr kann man mit einem 8''-Teleskop einfangen bei günstigen Bedingungen - mit Langzeitbelichtung.
Für die Betrachtung von Galaxien zählt vor allem eines: ein dunkler Himmel. Galaxien sind die ersten "Opfer" der allgemeinen Lichtverschmutzung. Filter bringen hier - im Unterschied zu Nebeln - nichts, da Galaxien im ganzen Lichtspektrum strahlen. Einzig M31/Andromeda ist am Nordhimmel auch bei schlechteren Bedingungen zu sehen.
4.11 Schnelle Objekte
Zu den schnellen Objekten zählen vor allem Meteoroiden,
Asteroiden und Kometen. Deren Beobachtung war schon in der
Frühgeschichte von Bedeutung, als Astronomie und
Astrologie noch nicht getrennt waren. Sie galten als
Ankündigungen besonderer Ereignisse und ihr Erscheinen
wurde mit Weissagungen verbunden. Die biblischen drei
"Weisen aus dem Morgenlande" waren mit großer
Wahrscheinlichkeit babylonische Astronomen-Astrologen und
sie folgten nach landläufiger Überzeugung dem Erscheinen
eines Kometen. Inzwischen wird allerdings davon
ausgegangen, dass sie einer Jupiter-Saturn-Konjunktion auf
der Spur waren, von der auf einer 1925 aufgefundenen
Keilschrifttafel berichtet wird, die 7 v. Chr. gleich
dreimal stattfand, also im Jahr der wahrscheinlichen
Geburt des historischen Jesus.
Die kleineren Meteoroiden entstehen bei der Kollision von
Asteroiden. Die meisten in Erdnähe kommenden Asteroiden
und die weitgehend in der Erdatmosphäre verglühenden
Meteoroiden (Sternschnuppen/Meteore) kommen aus dem
Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter.
Kometen dagegen stammen von weiter her, die meisten aus
dem Kuiper-Gürtel am Rand unseres Planetensystems, in
welchem auch Zwergplaneten wie Eris und Pluto kreisen,
manche kommen auch aus der extrem ausgedehnten Oortschen
Wolke, die sich um unser Sonnensystem zieht und deren
äußerste Bereiche 1,5 Lichtjahre von uns entfernt liegen.
Nicht im engeren Sinne zu den Himmelsobjekten zählen Raumstationen und Satelliten, sie können als Objekte am Himmel aber auch mit Teleskopen beobachtet werden. Die genaue Anzahl der Satelliten, die im Orbit um die Erde kreisen, ist vage, einschließlich der nicht mehr funktionierenden Geräte dürften es etwa 10.000 sein derzeit, dazu kommen Bruchstücke von bei Kollisionen zerstörten Satelliten. Begonnen hatte es mit dem sowjetischen Sputnik am 04. Oktober 1957. Elon Musks Gesellschaft SpaceX (ein ganz und gar unsowjetisches Unternehmen mit dem Ziel "schnelles Internet aus dem All") hat die Erlaubnis, zusätzlich zu seinen bereits vorhanden erdnahen 1.900 Star-Link-Satelliten 11.000 weitere auf eine Erdumlaufbahn zu schicken - mit dem Fernziel von 42.000 Satelliten! Was zunehmend zur Besorgnis (nicht nur) unter Astronomen führt, denn besonders mit erdnahen Satelliten und deren Reflexionen können astronomische Beobachtungen gestört werden.
Auch die Beobachtung von Flugzeugen mit dem Teleskop ist
verbreitet. Wie bei allen schnellen Objekten sollte eine
kleinere Vergrößerung gewählt werden, da sonst die
Nachführung hektisch wird. Teleskope mit kurzer Brennweite
sind für alle schnellen Objekte wegen des weiten
Gesichtsfeldes sinnvoll. Dazu kommt bei fernen kleinen
Objekten wie Kometen und Asteroiden die Notwendigkeit zu
einer hohen Auflösung, also einer großen Öffnung.
4.12 Sternbilder
Kinder wollen beim ersten Teleskopieren gerne "Sternbilder
sehen". Sie sind enttäuscht, wenn sie erfahren, dass
Sternbilder keine objektiven Größen am Himmel sind, deren
Sterne in einer realen, physikalischen Verbindung zueinander
stehen. Daher zählen Sternbilder genau genommen nicht zu den
Himmelsobjekten. Auch wenn z.B. einige Sterne des "Großen
Bären" zum sogenannten "Bärenstrom" gehören, einem noch
nicht vollständig definierten Sternhaufen mit gemeinsamer
Bewegungsrichtung. Dass die einzelnen Sterne eines
Sternbildes unterschiedlich weit von der Erde entfernt
stehen und unterschiedliche Entstehungszeiten haben können,
ist für Kinder zunächst wenig nachvollziehbar. "Und warum
heißen die dann so?" Es ist gut, sie daran zu erinnern, wie
sie schon oft gesagt haben, "diese Wolke sieht aus wie ein
Pferd" oder Ähnliches.HAMLET Do you see yonder cloud that’s almost in
shape of a camel?
POLONIUS By th’ Mass, and ’tis like a camel indeed.
HAMLET Methinks it is like a weasel.
POLONIUS It is backed like a weasel.
HAMLET Or like a whale.
POLONIUS Very like a whale.
Die in Europa astrologisch genutzten Tierkreiszeichen stammen aus dem allgemeinen Fundus der Sternbilder und wurden in der griechisch-ägyptischen Antike bisheriger Erkenntnis zufolge in Alexandria zum Tierkreis entwickelt, offenkundig unter starkem Einfluß durch die Kultur des späten babylonischen Reiches. Sie hängen vom Gang der Sonne ab und wiederholen sich nach dem Ablauf eines Jahres. Die chinesischen Tierkreiszeichen dagegen sind im Jahreslauf vom Gang des Mondes abhängig und zugleich auch einem Jahr zugeordnet, sie wiederholen sich alle zwölf Jahre.
Für die Astronomie sind Sternbilder vor allem zur raschen Orientierung am Himmel wichtig. Sie bieten auch gut identifizierbare Absprungpunkte für das Auffinden von Deep Sky Objekten. Etwa die Jungfrau und das Haar der Berenike, die zwei wichtigen Galaxienhaufen vorgelagert sind. Oder Löwe, der uns zu den beiden Leo-Galaxien-Gruppen (M66, M96) führt. Oder der Große Bär mit gleich drei auch mit dem Fernglas aufzuspürenden Galaxien. Oder Adler, der uns zu einer ganzen Fülle mit dem Fernglas schön anzuschauender Objekte führt.
Eine Sonderrolle spielen die für die verschiedenen Jahreszeiten jeweils charakteristischen Konstellationen. Das Frühlingsdreieck wird gebildet durch Arktur/Arcturus (Bärenhüter/Rinderhüter - "arctouros" gr. der Wächter), Spica (Jungfrau) und Regulus (Löwe). Das Sommerdreieck besteht aus Wega (Leier), Deneb (Schwan) und Altair (Ader). Der Herbsthimmel wird markiert durch das Herbstviereck aus Algenib, Markab und Scheat (alle Pegasus) sowie Alpheratz (früher Pegasus, heute Andromeda). Im Winter kann man sich am Winterdreieck Sirius (Großer Hund), Prokyon (Kleiner Hund), Rigel (Orion) orientieren oder am Wintersechseck aus Capella, Aldebaran, Rigel, Sirius, Prokyon und Pollux.
Kleine Asterismen wie der Kleiderbügel oder Sternbilder wie der Delphin machen viel Freude im Fernglas. Auch der Asterismus Kembles Kaskade im Sternbild Camelopardalis, eine Kette von etwa 20 Sternen, gehört zu den dankbaren Standardobjekten der Fernglasastronomie. Der kanadische Franziskanermönch Pater Lucien Kemble fand die Kaskade, als er mit einem Fernglas 7x35 den Himmel erkundete.
5 Probleme und Lösungen
Ich schreibe hier auf, womit ich selbst oder andere Probleme
hatten und biete Lösungen aus eigener und fremder Praxis,
die den Einstieg in die Astronomie erleichtern und Wege
zeigen aus den Frustrationen des Anfangs hin zu den
bereichernden Erfahrungen dieses Hobbys.Geben Sie sich und ihrem ersten Teleskop grundsätzlich einen ganzen Jahreslauf, ehe Sie sich an eine Quintessenz Ihrer Erfahrungen machen. Der Sternhimmel ist zu jeder Jahreszeit, in jeder Nacht, zu jeder Nachtzeit, bei jeder Witterung, jedem Mondstand ein anderer. Und entsprechend anders werden Ihre Erfahrungen mit dem Himmel und Ihrem Teleskop sein. Vielleicht versagt ihr Teleskop zunächst bei Planeten, ist aber großartig bei Sternhaufen und Galaxien. Oder anders herum. Vielleicht haben Sie nur das falsche Okular verwendet. Haben Sie Geduld, lassen Sie ein Jahr vergehen.
Lernen Sie, worin Ihr Teleskop stark ist, im Vergrößern oder im Erfassen auch schwacher Lichtschimmer, in der Auflösung oder im Überblick. Und bei allen Problemen, die kommen werden: Probieren Sie es zunächst einmal mit einer geringeren Vergrößerung, ob dann Ihr Problem auch geringer wird. Eine hohe Vergrößerung bedeutet ein kleines Gesichtsfeld, Orientierungslosigkeit, Tunnelblick. Sie bedeutet eine kleine Austrittspupille, also ein kleines, dunkleres Bild, das bei ihnen ankommt oder vielleicht auch gar nicht ankommt, weil sie buchstäblich daneben sehen.
Und wenn Sie Nebel und Galaxien sehen wollen, müssen Sie sich Plätze suchen, an denen auch das Milchstraßenband zu sehen ist, begnügen Sie sich nicht mit dem lichtverseuchten Himmel, den wir für normal halten inzwischen. Nutzen Sie dafür klare Nächte, auch wenn es mal einen Teil des Schlafes kostet.
Nehmen Sie die Angaben, was mit welcher Vergrößerung oder welcher Öffnung zu sehen ist, nur als Orientierung, nicht als Maßstab! Zum Ringnebel (ein Planetarischer Nebel in der Leier) werden sie folgende Angaben finden: Mit dem Fernglas nicht zu sehen. Mit dem Fernglas ab 40mm Öffnung zu sehen. Nur mit Teleskop ab 6'' zu sehen. Erst ab 10'' zu sehen. Was ist richtig? Alles! Abhängig von den Umständen und davon, was mit "sehen" gemeint ist. Wer eine diffuse Helligkeit oder ein gelegentliches Aufblitzen dort, wo der Ringnebel steht, für hinreichend hält, der "sieht" ihn unter sehr günstigen Umständen schon mit einem kleinen Fernglas. Wer mit einem Wattebausch zufrieden ist, an dem unter günstigen Umständen schon eine Ringstruktur geahnt werden kann, der "sieht" ihn mit 6 Zoll (150mm). Wer ihn aber von anderen Planetarischen Nebeln nicht nur seines Standortes wegen unterscheiden möchte, der "sieht" ihn vielleicht erst mit 10 Zoll (250mm).
Und nicht nur die Ausrüstung, auch unser individuelles Sehvermögen und unsere Erfahrung, Luftfeuchtigkeit und Luftverschmutzung, Streulicht und Nachtzeit, Bodenvibrationen und andere Faktoren bedingen mit, was wann wie zu sehen ist.
5.1 (Fast) nichts zu sehen
Anders als in den Werbeprospekten der Hersteller und Händler zu lesen, ist es nicht so weit her mit dem "Auspacken und Loslegen" nach dem Teleskopkauf. Klar, den Mond anzuschauen und Jupiter und Saturn, das klappt meist zügig. Auch wenn selbst der Mond mit einem Fernglas weit einfacher anzupeilen ist als mit dem Teleskop. Aber darüber hinaus ist das Ergebnis von Peilversuchen zu Beginn oft nur: Gähnende Schwärze. Oder Grau.In vielen Ratgebern steht, dass man als erstes schauen sollte, ob der Objektivdeckel vorne am Teleskop abgenommen ist. Was schätzungsweise maximal 1% der Probleme betrifft. Um die anderen 99% geht es hier. Das am meisten unterschätzte Problem ist das des richtigen Einblicks in das Okular. Wobei es starke Unterschiede zwischen den Menschen gibt. Manche Leute schauen schon auf Anhieb schnurstracks gerade durch das Okular und haben "Durchblick", andere sehen erst mal und immer wieder nur das Schwarze der Okularinnenwand - vor allem bei einer verengten Austrittspupille wegen einer (zu) hohen Vergrößerung. Oder aber weil sie mit dem Auge zu nah oder zu fern der augenseitigen Okularlinse sind.
Hier hilft nur Ausprobieren! Das heißt, Vergrößerung runter, durchschauen und mit den Augen rollen, durchschauen und den Kopf verschieben, neigen in verschiedene Richtungen, den Augenabstand zum Okular verändern. Wir haben unterschiedliche Anatomien, da muss jeder für sich seine Lösungen finden. Manche schwören darauf, das andere Auge mit einer Klappe abzudecken, andere schauen irgendwann nur noch beidäugig mit Binokularaufsatz - der allerdings Licht schluckt.
TIPP: ÜBEN SIE AUCH BEI TAGE - IM SCHATTEN.
Nehmen Sie sich die Freiheit, die ersten Geh- und Sehversuche am Teleskop bei Tag zu machen. Achten Sie darauf, im Schatten zu stehen - wegen des seitlichen Lichteinfalls und der Gefahr, aus Versehen in die Sonne zu schauen. Suchen Sie sich einen entfernten Kirchturm oder einen Baum am Horizont und üben Sie! Im Unterschied zu den Objekten am Himmel ist ein Turm einfach zu finden - und er bleibt stehen! Nehmen Sie sich dabei auch alle verschiedenen Okulare, Prismen und Filter vor, die sie haben! Deren Besonderheiten können Sie bei Tageslicht schon ganz gut erkennen und vergleichen. Sie müssen üben, üben, üben - auch wenn davon in den Werbeprospekten nichts steht! Nachts sollten dann die Griffe und Einstellungen sitzen!
Sehr gut lässt sich auch der Umgang mit einer GoTo-Steuerung bei Tag üben. Die Polausrichtung ist mit Kompass und Gradmesser hinzubekommen, wo die Objekte stehen, können Sie auf einer Sternhimmel-App sehen und über Peilung vergleichen mit der Position, die ihre Go-To-Steuerung angefahren hat.
Wenn in der Nacht nichts zu sehen ist, kann das auch daran liegen, dass Sie mit einer kurzen Okular-Brennweite (= hohe Vergrößerung) in einen "leeren" Bereich schauen - leer zumindest für die Lichtstärke Ihres Objektivs. Da hilft ein Okular mit langer Brennweite (= geringere Vergrößerung) und entsprechend größerem Gesichtsfeld.
Wenn tagsüber das Bild weiß oder hellgrau ist, stimmt vermutlich der Fokus nicht. Da hilft es nur, fleißig in beiden Richtungen an der Fokussierung zu drehen. Ohnedies sollten sie die Fokussierung zu Beginn voll durchspielen, um den Spielraum kennenzulernen. Und Sie sollten sich gleich am Teleskop notieren (mit Aufklebern z.B.), wo bei der Fokuseinstellung Fern, wo Nah liegt. Und am Zoomokular - sofern Sie eines haben - sollten sie sich bei Licht merken, in welche Richtung sie drehen müssen zur Vergrößerung bzw. Verkleinerung. Wenn Sie gerade die Astrokamera ausprobieren, dann kann das Weiß/Grau gleichfalls am schlechten Fokus liegen - oder an einer zu hohen Belichtung. Stellen Sie bei der Erprobung am Tage auf automatische Belichtung/Exposure/Aufnahme.
Ein Grauschleier bei Nacht kann auch auf Lichtverschmutzung hinweisen. Dagegen hilft am Besten ein Standortwechsel. Wenn das nicht geht, probieren Sie es mit den einfachen Nebelfiltern (UHC oder, stärker, OIII), die filtern auch Straßenlampenlicht teilweise heraus.
Und wenn Sie nur einen Lichtpunkt oder den berühmten "Wattebausch" sehen, wo andere mit der gleichen Ausstattung nach eigenen Angaben eine Galaxie, einen Sternhaufen oder einen Planetarischen Nebel gesehen haben: Vermutlich haben die genau das Gleiche gesehen wie Sie. Nur haben die eben "gewusst", was sie da sehen.
5.2 Unscharf, wackelig, schnell weg
Nun hat man endlich den Saturn schön im Okular und dann
bekommt man ihn nicht scharf! Das kann ganz verschiedene
Gründe haben. Befindet man sich im Siedlungsbereich, handelt
es sich vermutlich um Luftturbulenzen, aufsteigende
Warmluft. Zu erkennen manchmal daran, dass das Bild
zwischendurch kurz scharf wird und dann wieder wegwabert.
Warme Luftbewegungen sind auch schuld daran, dass es nicht
viel Sinn macht, im Winter durch einen Spalt im Fenster das
Teleskop nach draußen zu richten. Keine Gute Idee ist es
auch, mit dem Teleskop durch Fensterglas zu schauen.
Luftbewegungen und Lichtbrechungen an unterschiedlich
temperierten Luftschichten sind auch verantwortlich dafür,
dass Betrachtungen in Horizontnähe meist wenig erfreulich
sind - mal ganz abgesehen von der Lichtverschmutzung, die in
Horizontnähe gleichfalls höher ist. Ärgerlich ist auch eine
hohe Luftfeuchtigkeit z.B. im Herbst. Dann haben die Sterne
einen je nach Helligkeit mehr oder weniger ausgeprägten Hof
- was aussieht, als seien die Linsen beschlagen (was
nebenbei auch passieren kann).Wenn diese Gründe wegfallen, kann eine zu hoch gewählte Vergrößerung schuld sein. Eine Faustregel besagt, dass die Vergrößerung maximal dem Objektivdurchmesser in Millimetern entsprechen sollte. Ein 200er Objektiv (8 Zoll) leistet scharf und lichtstark maximal eine 200fache Vergrößerung. Bis zum doppelten Wert kann man mit Abstrichen an der Qualität noch gehen, aber danach wirds dann unscharf und flau. Ich orientiere mich am 1,5fachen Wert. Das ist aber auch von den Umständen und dem besuchten Objekt abhängig.
TIPP: MIT NIEDRIGEN VERGRÖßERUNGEN BEGINNEN!
Ein dritter Grund kann schlicht und einfach Ungeduld sein. Da drehen wir beim Fokussieren immer wieder über den Schärfepunkt hinweg. Und warten nicht nach jeder Fokusveränderung kurz auf die Bildberuhigung. In seltenen Fällen ist auch die Kollimation schlecht (geworden). Bei Newtons muss gelegentlich der Hauptspiegel neu justiert werden, vor allem nach Erschütterungen, etwa bei einem Transport. Beim ersten Kauf sollte man einen Händler wählen, der vor Versand die Kollimation überprüft. Oder Freunde haben, die das für einen tun können.
Wackelbilder sind meist auf schwache Stative oder Montierungen zurückzuführen. Vibrationen, die eine optische Unschärfe erzeugen, sind nach Berührung des Teleskops normal, da muss eine gewisse Ausschwingzeit abgewartet werden. Störende Schwingungen können auch vom Boden kommen - auf einem leicht gebauten Balkon etwa oder bei LKW-Verkehr in der Nähe. Hohe Vergrößerung bringt schon bei kleinsten Schwingungen Wackelbilder, wenn Stativ/Montierung und Untergrund nicht optimal sind. Also im Zweifelsfall auch bei diesem Problem mit geringeren Vergrößerungen Erfahrungen sammeln. Und ggf. das Stativ oder den Standort wechseln.
Ärgerlich ist es auch, wenn das Objekt der Begierde rasch aus dem Blickfeld verschwindet. Auch hier kann eine geringere Vergrößerung Ruhe reinbringen. Aber grundsätzlich sollte man sich bei diesem Problem mit dem Thema "Nachführung" beschäftigen. Da die Erde sich dreht, dreht sich eben auch - scheinbar - der Sternenhimmel in Gegenrichtung um uns, wie die Sonne. Das müssen wir ausgleichen. Entweder von Hand (Schubsen beim Dobson, Drehen bei azimutaler Montierung) oder mit Motorensteuerung. Führt man selbst mit Motorensteuerung nach, ist eine geringere Motorengeschwindigkeit zu wählen. Bei automatischer Nachführung kann es ganz unterschiedliche Gründe für das Versagen der Nachführung geben je nach Software und Montierung. Da kann ich nur ein geduldiges Studium des Handbuchs empfehlen - und Ausprobieren! Bei billigen GoTo-Montierungen kann es schlicht an den technischen Möglichkeiten liegen, da hilft dann - wieder einmal - nur eine geringere Vergrößerung.
Auch beim Okularwechsel kann das Objekt verschwinden. Die Theorie lautet ja so: Erst das Objekt mit geringer Vergrößerung aufsuchen, schön zentrieren und schärfen, dann ein Okular mit höherer Vergrößerung aufsetzen. Die Praxis sieht oft - gerade für Anfänger - so aus: Okular gewechselt, Objekt verschwunden. Das kann viele Gründe haben: Die Nachführgenauigkeit der Teleskopmontierung ist zu schwach. Oder: Beim Okularwechsel wurde nicht mit der Exaktheit eines Optikers gearbeitet (stand das nicht im Werbeprospekt?) und das Teleskop ist um den entscheidenden Millimeter verruckelt. Oder: Das zweite Okular hat eine andere Mitte als das alte. Was in der Regel nicht an den Okularen liegt, sondern daran, dass die Aufnahmehülse ein Spiel hat, das mit den beiden Feststellschrauben nie wirklich identisch korrigiert wird. Und dazu kommt noch, dass das zweite Okular einen anderen Fokus als das erste hat, wenn man nicht eine abgestimmte Serie von Okularen benutzt.
Abhilfe? Geduld. Übung. Geduld. Sonst verstaubt wieder mal eine Ausrüstung nach einigen Frustrationen und immerhin Mond, Jupiter und ganz viele wacklige Lichtpunkte gesehen auf dem Dachboden.
5.3 Und nochmal: Wackelpudding
Ich vermute, die meisten Resignationen beim Einstieg in die
Astronomie kommen vom Wackelpudding. Es nervt einfach, nur
wackelnde Lichter zu sehen, welche Sterne oder Planeten sein
sollen!Besonders gravierend ist das Problem beim frei gehaltenen Fernglas (und nebenbei auch bei hohen Vergrößerungen im Teleskop). Ab 10facher Vergrößerung gibts mit dem Glas Probleme. Und da hilft auch keine ruhige Hand, denn wir atmen und wir haben einen Pulsschlag, das genügt schon für Wackelbilder. Mit zunehmender Vergrößerung wird eben der Winkel zwischen zwei Punkten im anvisierten Objektbereich größer - und damit die optische Auswirkung von geringsten Bewegungen. Entsprechend ist überall zu lesen, ab dieser Vergrößerung benötigten wir ein Stativ. Ich habe mit dem Fernglas die unterschiedlichsten Varianten von Stativen ausprobiert und für mich entschieden, dass ich die nur bei Jupiter und Saturn einsetze. Ansonsten bin ich freihand oder mit Seilaufhängung auf einem variablen Stuhl/Sessel sitzend unterwegs am Himmel. Denn auch am Stativ fassen wir das Fernglas an oder berühren es zumindest mit der Augenumgebung. Und mir ist zudem immer was vom Stativ im Weg. Oder der Nacken macht schlapp.
TIPP: FERNGLASAUFHÄNGUNG AM SEIL, GEHIRN LERNEN LASSEN.
Abhilfe versprechen Ferngläser mit Bewegungskorrektur. Aufwendig mechanisch und entsprechend sehr teuer bei Zeiss (20x60 S), digital mit Batterien einiges günstiger bei Canon (15x50 IS). Aber auch unser Gehirn ist in der Lage, Wackelbilder zu stabilisieren. Allerdings geht das dann nicht auf Knopfdruck, es erfordert Übung, Erfahrung und Geduld. Also bitte nicht vorschnell resignieren. Immer wieder probieren, einfache Objekte aussuchen, mit geringen Vergrößerungen arbeiten, dran bleiben! Dann kommen auch die Erfolgserlebnisse, bescheidener vielleicht als erwartet, aber lohnend!
5.4 Auf dem Kopf stehend
Dass der Himmel im Teleskop meist Kopf steht, fällt nicht unbedingt gleich auf, führt aber immer wieder zu Irritationen, vor allem beim Ansteuern der Objekte. Ein Zenitspiegel (der primär das Licht für den besseren Einblick ins Okular um 90° umlenkt) richtet das Bild auf, belässt aber die Seiten verkehrt, ein Amici-Prisma oder eine Umkehrlinse sorgen für ein korrektes Bild. Wer zwei Sucher (einen mit direktem Durchblick, einen mit Umlenkwinkel für tiefe Einblicke) benutzt, kann also durchaus drei verschiedene Bilder bekommen, ein korrektes, ein kopfstehendes und ein seitenverkehrtes. Das ist sicherlich nicht sinnvoll, da sollte auf eine einheitliche Lösung geachtet werden.Steht das Bild Kopf, wird empfohlen, die verwendete Sternenkarte oder das Smartphone mit der Astronomie-App zu drehen. Beim Smartphone muss dann aber die automatische Bilddrehung abgeschaltet werden.
TIPP: VERSCHIEDENE BILDORIENTIERUNGEN AUSPROBIEREN!
Wir stellen uns sicherlich rasch auf das kopfstehende Bild ein und steuern die Motoren bald nicht mehr in die falsche Richtung oder haben eine entsprechende Einstellung in der Motorensteuerung, die das korrigiert. Ich meine allerdings, dass es die Erstellung der "Mental Map" stört, wenn ich ständig zwischen zwei verschiedenen Bildausrichtungen wechseln muss. Daher bin ich ein Anhänger des Amici-Prismas für den Einstieg (falls man nicht ohnedies mit dem Fernglas anfängt). Mit den Himmelsrotationen im Tagesverlauf und den Verschiebungen im Jahresverlauf haben wir schon genügend Gehirnjogging zu leisten als Amateurastronomen. Aber es gibt Brillanzverlust durch das Amici-Prisma, daher empfiehlt sich schon irgendwann der Umstieg. Auch soll die korrekte Ausrichtung des Bildes im Okular nicht überbewertet werden. Faktisch sehen wir im Okular ohnedies selten viel vom Umfeld des Zielobjektes. Und das, was wir sehen, hat mit dem Blick durch den Sucher auch bei gleicher Ausrichtung der höheren Vergrößerung wegen meist prima vista wenig zu tun.
Und ich kenne durchaus Leute, die schon zu Beginn gut damit zurecht kommen, im Sucher ein Normalbild, im Okular ein kopfstehendes oder nur seitenverkehrtes zu haben. Einfach ausprobieren. Der Sucher sollte in jedem Falle ein Normalbild liefern, da wir sein Bild mit dem Realbild abgleichen müssen. Außerdem können wir dann einfacher die Aufsuchwege für Objekte vom Fernglas auf den Sucher übertragen.
Übrigens: Einer steht auch ohne Amici-Prisma nicht Kopf. Der Weihnachtsbaum-Sternhaufen. Er wurde (wie auch der gleichnamige Nebel, in welchem er zuhause ist) offensichtlich nach dem Blick durch ein Teleskop ohne Bildaufrichtung so benannt! Und deshalb steht er im Normalanblick (also auch mit Amici-Prisma) Kopf.
5.5 Bei Nacht sind alle Katzen grau
Eine der größten Enttäuschungen für Einsteiger ist der wenig spektakuläre Anblick von Nebeln - sofern man sie überhaupt zu Gesicht bekommt. Mit den beeindruckenden, farbintensiven Fotografien, die es zuhauf in Printpublikationen und im Netz zu bewundern gibt, hat der Anblick grauer Socken, Waschlappen oder Wattebäuschen, den die meisten Nebel üblicherweise im Teleskop hergeben, wenig zu tun.
Das hat zwei objektive Gründe. Zum einen sind Farblichtstrahlungen wesentlich schwächer als das Weißlicht der Sterne, da sie nur einen kleinen Teil des Spektrums ausmachen, zum anderen nehmen unsere Augen bei Nacht vorwiegend Grauschattierungen war - wie uns die Redewendung "bei Nacht sind alle Katzen grau" schon sagt. Unsere Netzthaut verfügt über zwei Hauptrezeptoren für Lichtwahrnehmungen, Zäpfchen und Stäbchen. Farbwahrnehmungen kommen über die Zäpfchen zustande, die nur bei Tag/bei hellem Licht angesprochen werden. Das Nachtsehen ist reines Stäbchensehen - und die Stäbchen sind für Farbstrahlungen unempfindlich.
TIPP: ERWARTUNGEN RUNTERSCHRAUBEN!
Wer Farben erleben möchte, sollte sich zunächst in Bescheidenheit üben und an die lichtintensiven farbigen Sterne halten, Spica, Beteigeuze, Aldebaran, Erakis/Granatstern etwa. Sie zeigen bereits mit einfachen Mitteln, auch schon im lichtstarken Fernglas, etwas vom Farbenreichtum der nächtlichen Himmelsobjekte. Für zumindest ahnungsweise farbige Nebelerfahrungen sollten wir mit denjenigen Nebeln beginnen, die auch Blautöne haben, wie Schneeballnebel, Hantelnebel, Eulennebel.
Wer dann etwas mehr Farben sehen möchte, muss in eine lichtstarke Ausrüstung investieren, Plätze ohne Streulicht aufsuchen rund um Neumond, auf eine Insel wie Teneriffa oder in eine Wüste fahren, Filter anschaffen. Wirklich farbenintensiv wird es allerdings erst mit der Astrofotografie, mit Langzeitbelichtungen, mit Mehrfachbelichtungen unter Einsatz verschiedener Filter und Stacking. Daran können auch verbesserte digitale Teleskope mittelfristig wegen des Zeitfaktors nicht entscheidend etwas ändern. Aber Geduld gehört ja zu den Grundeigenschaften von Amateur-Astronomen.
5.6 Ich seh' etwas, was du nicht siehst!
Als Anfänger fühlt man sich oft etwas veräppelt wenn da ein
alter Fuchs berichtet, was er alles mit welch mickriger
Ausrüstung gesehen habe. Und man selbst sieht nichts.
Buchstäblich nichts!Das kann, jetzt will ich mal gemein sein, daran liegen, dass auch der alte Fuchs nichts gesehen hat, aber nach dem Motto "Wir sehen was wir wissen" eine Linsentrübung oder eine optische Täuschung für sein Objekt hielt. Dagegen ist niemand von uns gefeit. Nach zwei Stunden in der Kälte sind wir auch mal für eine kleine Halluzination dankbar. Und auf den Planetariumsapps können wir das ja alles sehen und innerlich an den Himmel projizieren!
Wahrscheinlicher sind jedoch andere Lösungen. Als Anfänger haben wir noch einen engeren Begriff von "Sehen". Bei einer diffusen Helligkeit würden wir noch nicht sagen, wir hätten den Sternhaufen XY oder den Nebel AO gesehen. Zumal wir vermutlich gar nicht wüßten, dass wir genau dies mit der Helligkeit "gesehen" haben. Falls wir sie überhaupt gesehen, und nicht einfach ignoriert haben.
TIPP: GESUNDES MISSTRAUEN UND GEDULD.
Mit fortgeschrittener Praxis im Sternegucken werden wir dann auch die Erfahrung machen, dass wir zum Beispiel mit dem Glas im Offenen Sternhaufen M41 gerade zwei der Orangenen Riesen prächtig funkeln sahen - und eine halbe Stunde später sehen wir von den beiden nichts mehr außer vielleicht einem Flackern. Das soll uns aufmerksam machen für die Singularität unserer astrologischen Erfahrungen. Sie sind extrem abhängig von Ort, Zeit und sonstigen Rahmenbedingungen - und nicht nur vom Gerät!
Ein besonders spektakuläres Beispiel für die Abhängigkeit von Rahmenbedingungen ist der Kaliforniennebel. Es gibt belastbare Berichte von Leuten, die ihn mit vorgehaltenem Nebelfilter gesehen haben - während andere ihn über Jahre verfolgen, bis sie ihn zum ersten Mal mit einem lichtstarken Glas und einem Paar verdammt teurer Spezialfilter sehen. Harrington nennt ihn in "Touring the Universe through Binoculars" von 1990 "a paradoxical object".
Hier eine kleine, unvollständige Liste dessen, was unseren Seheindruck negativ beeinträchtigen kann, geordnet von nah zu fern: Ermüdung der Augen, beschlagenes Okular, Streulicht, Warmluft aus des Nachbarn Kamin, Luftfeuchtigkeit, Vulkanasche oder Saharasand in der Atmosphäre und schließlich eine Staubwolke, die vor Zeiten zwischen der Erde und dem Objekt durch den Kosmos zog. Wir sind also in hohem Maße auch von Zufällen abhängig, in einer gewissen Weise Glücksritter, die auf den günstigen Moment hoffen.
5.7 Der richtige Zeitpunkt
Eines vorweg: Es gibt keine Zeit für die Hobby-Astronomie.
Im Winter ist es zu kalt, im Sommer wird es zu spät dunkel
bzw. nicht wirklich dunkel (weil die Sonne bei uns dann
nicht sonderlich weit unter den Horizont sinkt -
Mittsommernachtsphänomen). Und im Frühling und im Herbst ist
es häufig bewölkt und regnerisch - gerne in der Zeit um
Neumond. Wenn Sie also bereit sind, viel Geld für eine
Ausrüstung auszugeben, die Sie selten einsetzen können:
Willkommen im Club. Falls nicht: Suchen Sie sich ein anderes
Hobby. Oder seien Sie vorbereitet auf die klammen Finger im
Winter, die Nächte ohne Schlaf im Sommer, die Jagd auf ein
Wolkenfenster in den Übergangsjahreszeiten.Über das richtige Teleskop für die eigenen Interessen wird viel diskutiert und informiert. Will ich also eher Planeten oder eher Galaxien, eher Nebel oder eher Sternhaufen anschauen, eher fotografieren oder eher in Ruhe betrachten, eher Details von Planeten sehen, Kugelhaufen auflösen oder Strukturen von Nebeln studieren - entsprechend sollte ich Tuben und Okulare wählen. Und dann hab ich als Anfänger ein Gerät gekauft, das angeblich auch für Nebel taugt und ich sehe nichts von den Nebeln. Nada. Obwohl sie da sind. Aber leider sind das gerade die falschen, die ich mit meiner Ausrüstung, den verwendeten Filtern nicht sehen kann.
Und daher müssen wir auch über Jahreszeiten reden. Es gibt zum Beispiel zwei Nebelzeiten, eine im Winter, eine im Sommer. Die im Winter wartet mit den eher schwierigen Nebeln auf, mal abgesehen vom Orion-Nebel. Um im Winter erfolgreich Nebel anzuschauen, sollte ich schon einen 8-Zöller haben. Für viele schöne Nebel der Sommerzeit reichen auch 5 Zoll. Oder das lichtstarke Fernglas. Ähnliches gilt für Galaxien, ihre Zeiten liegen im Herbst und im Frühjahr. Und auch für die Planeten gilt ein Terminplan. Manchmal im Jahreslauf sind kaum welche zu sehen, vielleicht die Venus am Morgen oder am Abend - und dann (fast) alle auf einmal, wenn ich die richtige Jahres- und Uhrzeit erwische.
TIPP: DEM NEUEN TELESKOP EIN JAHR ZEIT GÖNNEN!
Klar, was ich sehen kann, hängt auch von meiner Ausrüstung ab. Aber unser technisches Zeitalter setzt auf Geräte, nicht auf den richtigen Zeitpunkt. Alles soll jederzeit verfügbar sein. Und daher kaufen wir Zusatzgeräte, neue Okular, Filter - statt einfach abzuwarten. Die richtige Stunde in der Nacht. Die richtige Nacht im Monat. Den richtigen Monat im Jahr. Tomaten gibt es inzwischen das ganze Jahr. Den Orion aber können wir nur in bestimmten Monaten und Nachtzeiten gut sehen, ebenso den wundervollen Lagunennebel. Und nicht ärgern, wenn es zu bestimmten Jahreszeiten gehäuft statt eines klaren Anblicks Blicke wie durch eine Milchglasscheibe gibt, mit romantischen Halos um die Objekte: Dann ist die Luftfeuchtigkeit zu groß, das Licht der Objekte wird von Wassertröpfchen oder Eiskristallen in der Atmosphäre gebrochen.
Ehe ich also ein Urteil über mein neues Teleskop fälle, sollte ich einen Jahreslauf vollenden. Denn jede Jahreszeit hat ihre Besonderheiten am Sternhimmel - und fordert andere Eigenschaften an meinem Teleskop heraus. Wenn im Sommer die Planeten wie aufgereiht am Himmel stehen, freue ich mich über eine lange Brennweite (ergo hohes Vergrößerungspotential) meines Teleskops, die mich im Frühling nervt, wenn ich Spiralgalaxien sehen möchte und keine hohe Vergrößerung, sondern viel Lichtsammelleistung brauche.
5.8 Die Himmelsrichtung
Für Anfänger gibt es gelegentlich das Problem, dass ihr
lange gesuchtes Objekt bald nach dem Finden zügig in der
Horizonthelligkeit verschwindet. Das passiert bei Blicken
Richtung Westen. Denn was wir unbedingt berücksichtigen
müssen: Wie die Sonne gehen auch die Sterne - grosso modo -
im Osten auf und im Westen unter. Beide scheinhafte
Bewegungen basieren ja auf der Drehung der Erde um die
eigene Achse.Mehrere Gründe sprechen dafür, sich mit der Betrachtung auf den Osthimmel zu konzentrieren. Einmal eben der Sternenaufgang dort, der uns die Beobachtung besser strukturieren lässt und die oben genannte Frustration erspart. Zum Zweiten haben wir im Osten nicht das Sonnenrestlicht vom Sonnenuntergang. Und drittens stehen in den Hauptbeobachtungszeiten (bestimmt durch freundliche Witterung plus gemäßigte Tageslänge) im Frühjahr und im Herbst ausreichend für Anfänger interessante Objekte Richtung Osten. Dazu kommt für mich hier am Kraichgaurand, dass im Westen die Rheinschiene mit ihrer massiven Lichtverschmutzung liegt.
TIPP: IM OSTEN OBEN (ZENITNÄHE) BEGINNEN MIT DER BEOBACHTUNG, IM WESTEN UNTEN (HORIZONTNÄHE).
Aus dem Sternenaufgang im Osten folgt auch, dass wir am Osthimmel mit den Objekten beginnen sollten, die am nächsten beim Zenit stehen, ehe wir uns für sie den Hals verrenken müssen. Am Westhimmel beginnen wir stattdessen sinnvoll mit denen, die am weitesten unten am Horizont sind und daher bald verschwinden werden.
Etwas andere Regeln gelten im Winter, der des frühen Sonnenuntergangs wegen für Fortgeschrittene oft die Hauptbeobachtungszeit ist. Hier steht der Westen - sofern man nicht gerade östlich von Mannheim/Ludwigshafen o.ä. wohnt - endlich offen für ausgiebige Beobachtung. Allerdings muss dafür mehr Aufwand getrieben werden: Abkühlzeiten für das Teleskop einplanen, Wärmekleidung, eventuell Beobachtungszelt mitnehmen und die Thermoskanne, das schwerere Outdoor-Fernglas schleppen, das nicht beschlägt innen bei hohen Temperaturdifferenzen.
Wer einen Messier-Marathon plant, alle Messier-Objekte in einer Nacht, "erfunden" in den 1970er Jahren in den USA, der macht das am Besten im Frühjahr und muss dann im Westen beginnen und endet frühmorgens mit einer Kaffeevergiftung im Osten. Dieser Ablauf ist der Lichtverhältnisse wegen nicht optimal, aber wegen des Sternelaufs notwendig.
5.9 Womit soll ich beginnen?
Ein typischer Anfängerfehler ist, sich ungeeignete Objekte
auszusuchen. Daran schuld sind die Versprechen des
Teleskopmarktes, die tollen Objekte-Fotos in Zeitschriften
und im Internet, falsch interpretierte Beobachtungsberichte.
Die tollen Fotos sind in der Regel mit Langzeitbelichtung,
Mehrfachbelichtung und Bildbearbeitung gemacht. Direkt zu
sehen ist so etwas nicht oder bestenfalls annähernd mit dem
Hubble-Teleskop. Aber wer hat schon Hubble zuhause stehen
... Und Beobachtungsberichte der Astronomie haben nichts mit
Alltagsbeobachtungen zu tun. Wenn ich sage, ich habe Herrn
oder Frau XY gesehen, dann meine ich, ich habe die Person
auch erkannt. Wenn ich sage, ich habe die Sombrero-Galaxie
im 20x80 Fernglas gesehen, dann heißt das, ich habe einen
kleinen Lichtpunkt oder Nebelfleck gesehen, von dem ich weiß
(vielleicht auch nur vermute), dass es die Sombrero-Galaxie
ist/war, aufgrund der Position. Und messen Sie sich nicht an
Beobachtungen, die in Reinluftgebieten ohne
Lichtverschmutzung gemacht wurden. Falls Sie nicht selbst in
solch einem Gebiet wohnen oder gerade dort Urlaub machen.Beginnen Sie mit dem Mond, Jupiter und Saturn. Da sehen Sie auch wirklich etwas, ein differenziertes Objekt mit charakteristischen Zügen. Wenn Sie dann etwas vertrauter sind mit Ausrüstung und Orientierung, sollten Sie zunächst Ausschau halten nach besonderen Einzelsternen, farbigen Sternen, unkomplizierten Doppelsternen, Offenen Sternhaufen und Kugelsternhaufen.
TIPP: KLEIN ANFANGEN.
Nach einiger Erfahrung können Sie sich dann an die einfacheren Planetarischen Nebel machen, als da sind: Allen voran der Hantelnebel/M27 im Sternbild Füchslein (mag 7.09) und der Helixnebel im Sternbild Wassermann (mag 7.59). Weiters die kleineren Nebel Saturnnebel im Sternbild Wassermann (mag 7.8), Katzenaugennebel im Drachen (mag 8.1), Blauer Schneeball im Sternbild Andromeda (mag 8.3) und Ringnebel/M57 im Sternbild Leier (mag 8.8). Der Eulennebel/M97 im Sternbild Großer Wagen (mag 9.8) ist wieder ausgedehnter, aber lichtschwach. Genannt werden auch gerne die eher anspruchsvollen Nebel Juwel-Nebel (mag 8.5), Blinkender Nebel (mag 8.89), Eskimonebel (mag 9.19) und Kleiner Hantelnebel/M76 (mag 10.1). Wobei nicht nur die Lichtstärke (mag - je geringer, je heller), sondern auch die Flächenausdehnung und die Farbigkeit für die Beobachtungschancen relevant sind.
Von den Galaxien stehen an erster Stelle Andromeda/M31 und die Dreiecksgalaxie/M33. Dann kommen die drei Bärengalaxien M51, M101 und M82, gefolgt vom Leo-Triplett M65, M66, NGC 3628 und der Leo-Gruppe M95, M96, M105. Lohnen kann sich die Mühe des Suchens für Anfänger auch bei der Sombrero-Galaxie M104 und der Feuerwerks-Galaxie NGC 6946.
Mit nicht-planetarischen Nebeln sollten Sie in den ersten beiden Beobachtungsjahren zurückhaltend sein, mal abgesehen vom Orionnebel und dem Lagunen-Nebel (der nur selten zu sehen ist). Sie ersparen sich damit viele unnötige Frustrationen.
5.10 Justierung
Wir werden in der Amateurastronomie mit drei verschiedenen
Justierungen konfrontiert, der Justierung des Suchers auf
das Teleskop, der Justierung des Teleskops auf den
Sternenhimmel (Alignment) und der - selten und nur bei
Reflektoren notwendigen - Justierung des Hauptspiegels
(Kollimation). Meist ist mit Justierung die Justierung des
Suchers gemeint, in den anderen beiden Fällen werden die
Spezialtermini verwendet. Auf die Kollimation beim Teleskop
gehe ich hier nicht ein, das ist Spezialwissen und stark vom
jeweiligen Gerät abhängig.Die Justierung des Suchers auf das Teleskop steht am Anfang der Beobachtung mit einem Teleskop. Aber warum brauchen wir überhaupt einen Sucher? Weil das Sehfeld im Teleskop zu eng ist, um eine Orientierung hinzubekommen, um zu erkennen, wo wir uns da gerade mit den Augen befinden, was wir da sehen. Der Sucher hat eine weit geringere Vergrößerung (sofern er überhaupt eine hat) als das Teleskop, weshalb sein Sehfeld weiter ist.
Empfohlen wird, die Justierung schon tagsüber an einem Objekt in mindestens einem Kilometer Entfernung vorzunehmen. Aus der physikalischen Optik wissen wir allerdings, dass diese Einstellung keineswegs exakt zum späteren Gebrauch für riesige Distanzen ist. Eigentlich müssten wir an einem Stern justieren. Das funktioniert allerdings aus einem ganz einfachen Grund nicht: die Sterne wandern, bewegen sich durch die Erddrehung während des Justierens. Selbst der Polarstern taumelt - zwar geringfügig, aber doch genug, um die Justierung ähnlich abweichen zu lassen wie die Justierung am fernen Kirchturm.
TIPP: JUSTIEREN "JUST IN TIME"!
Aber keine Sorge, eine besonders exakte Justierung würde uns ohnedies wenig nützen. Denn die Justierung gilt immer nur für das Okular, mit dem wir justiert haben. Mit der Optik eines anderen Okulars liegen wir schon ein wenig daneben. Und mit jeder Berührung am Sucher oder am Teleskop kann auch die Justierung gestört werden. Das gilt vor allem für das Auf- und Absetzen der Schutzkappen, aber z.B. auch für den Okularwechsel oder das Drehen am Fokussierknopf. Daher sollten nach der Justierung die Kappen nicht aufgesetzt werden bis zum späteren Teleskopeinsatz - und die Zeitspanne zwischen Justierung und Einsatz sollte möglichst kurz sein.
Und auch hier gilt wie grundsätzlich am Teleskop: Korrekt arbeiten, aber nicht die Freude am Schauen verderben durch Pedanterie!
5.11 Kollimation Fernglas
Beim Fernglas bedeutet Kollimation die Ausrichtung der
beiden Tuben (im Prinzip besteht ein Fernglas ja aus zwei
zusammenmontierten Teleskoptuben) aufeinander.
Qualitätsgläser sind in der Regel perfekt kollimiert. Nach
heftigeren Erschütterungen oder Temperaturschocks kann es
allerdings auch hier zu Dekollimationen kommen. Dann besser
zum Service bringen, denn eine Eigenkollimation birgt
Risiken, gerade bei aufwendig konstruierten Gläsern!Zeichen für eine besonders schlechte Kollimation sind Doppelbilder und Kopfschmerzen nach dem Sterne-Gucken. Auch Unschärfen und schwache Brillanz können auf Dekollimation verweisen. Was ein Grund für die Schwächen preisgünstiger Gläser ist. Allerdings können Gläser mit billigen Bauteilen nicht perfekt kollimiert werden.
Ich habe Kollimationserfahrung mit günstigen Großgläsern von TS Optics und APM gemacht, die das nötig hatten, auch ohne Kopfschmerzen. Dabei habe ich bislang noch keine technisch-opt
 ischen
Hilfsmittel eingesetzt. Der Arbeitsaufwand mit
Kollimationslasern ist bei Ferngläsern beträchtlich. Von TS
Optics gibt es eine sehr gute einschlägige PDF-Anleitung
(auf meiner Linkliste unter "Fernglasthemen") für die
Kollimation ohne Laser. Dazu ist nur eine leicht
aufzufindende Stellschraube pro Tubus, seitlich oben am
Prismenkopf, zu regulieren. APM schickt auf Nachfrage eine
sehr knappe Anleitung zum Auffinden der beiden
Stellschrauben (pro Tubus) an seinen Gläser, die sich oben
auf dem Prismenkopf neben den Okularen befinden (die nur
schwach angeklebte Gummiabdeckung muss abgehoben werden).
ischen
Hilfsmittel eingesetzt. Der Arbeitsaufwand mit
Kollimationslasern ist bei Ferngläsern beträchtlich. Von TS
Optics gibt es eine sehr gute einschlägige PDF-Anleitung
(auf meiner Linkliste unter "Fernglasthemen") für die
Kollimation ohne Laser. Dazu ist nur eine leicht
aufzufindende Stellschraube pro Tubus, seitlich oben am
Prismenkopf, zu regulieren. APM schickt auf Nachfrage eine
sehr knappe Anleitung zum Auffinden der beiden
Stellschrauben (pro Tubus) an seinen Gläser, die sich oben
auf dem Prismenkopf neben den Okularen befinden (die nur
schwach angeklebte Gummiabdeckung muss abgehoben werden).Zunächst sollten wir an einem Referenzglas eine gute Kollimation kennenlernen. Ich benutze mein Fujinon 10x50, um mit verschiedenen Kopfneigungen und -drehungen scheinbare Dekollimationen und bei korrekter Haltung die gute Kollimation zu erfahren.
TIPP: NICHT ZU FRÜH RUMSCHRAUBEN, MEHRMALS PRÜFEN. NICHT BEI QUALITÄTSGLÄSERN!
Das Glas sollte zur Kollimationsüberprüfung bei Tageslicht im Schatten auf einem Stativ stehen, seitliches Sonnenlicht vermeiden (kann einseitig aufheizen oder Augen irritieren). Ausrichten auf waagrechte und senkrechte Linien (Architektur z.B.) in mindestens 100 Metern Entfernung. Das Glas muss waagrecht stehen, eine Wasserwaage ist obligatorisch! Dann sind die Augen in 5-10 Zentimeter Abstand von den Okularen zu bringen. Die Achse zwischen den Augen muss waagrecht sein und parallel zur Achse der beiden Okulare. Im entspannten Geradeausblick die beiden Okularbilder wahrnehmen, sind sie gleich groß? Falls nicht, Kopf leicht drehen. Stehen die beiden Okularbilder waagrecht? Falls nicht, Kopf leicht seitlich neigen.
Dann kontrollieren, ob es Knicke in den waagrechten oder senkrechten Linien gibt. Schielen und Bewegung des Kopfes vermeiden! Bei Knicken entsprechend der PDF-Anleitung an den Schrauben drehen. Bei TS Optics gibt es nur eine (sehr kleine, Optikerschraubenzieher notwendig) Schraube pro Tubus, die das Prisma in beiden Richtungen (nach oben und unten sowie rechts und links) reguliert, also diagonal. Bei APM sind zwei etwas schwieriger zugängliche (aber größere und besser gängige) Schrauben pro Tubus zu drehen, eine für die horizontale, eine für die vertikale Regulierung (siehe Abbildung). Bei großen Abweichungen an beiden Tuben regulieren.
Eine andere Methode zur Kollimationsüberprüfung ist die nächtliche Ausrichtung des Glases auf einen markanten Stern. Den Stern in einem der Okulare defokussieren, so dass er diffus-groß wird. Dann schauen, ob der scharfe Stern des anderen Okulars in der Mitte des defokussierten Sterns liegt.
Dieses Verfahren lässt sich auch auf andere Gläser übertragen, Handbücher und Hersteller befragen! In der Regel befinden sich die Stellschrauben oben am Tubus, wie bei APM. In der Regel gilt für die Oben-Unten-Schraube an beiden Tuben: Drehung Uhrzeigersinn - Bildverschiebung nach unten, Drehung Gegenuhrzeiger - nach oben. Für die Rechts-Links-Schraube am rechten Tubus: Drehung Uhrzeigersinn - nach links. Am linken Tubus: Drehung Uhrzeigersinn - nach rechts. Aber nochmal: Nicht an teuren Qualitätsgläsern rumschrauben! Und vor dem Rumschrauben die Kollimation an verschiedenen Tagen überprüfen.
5.12 Alignment
Alignment heißt die Ausrichtung unserer Teleskopsteuerung auf den jeweiligen Himmelsanblick. Das geschieht meist manuell, kann aber auch elektronisch über digitale Bilderkennung geschehen. Beim manuellen Alignment sind wir auf eine einigermaßen stimmige Justierung zwischen Sucher und Teleskop angewiesen. Wir müssen beim manuellen Alignment in der Regel drei Sterne nacheinander ins Okularzentrum bringen, wobei die Software die zugehörigen Daten aufnimmt und dann verrechnet zu einem Himmelsbild. Dies muss rasch geschehen, da die Sterne, wie schon oben erinnert, während des ganzen Prozederes wandern. Um die drei Sterne jeweils im ersten Schritt ungefähr anzufahren, ist es hilfreich, sie mit Blicken am Tubus entlang anzupeilen. Denn das Anfahren mit dem Sucher alleine ist zeitaufwendig. Geübte Peiler können auf den Sucher beim Alignment ganz verzichten und benötigen nur noch den Blick durchs Okular zur Feinzentrierung. Dabei ist ein Okular mit geringer Vergrößerung wählen, sonst ist das Bildfeld zu eng um rasch das Objekt im Blick zu haben - und es dort auch zu behalten.TIPP: DAS PEILEN LERNEN!
Ich persönlich finde beim manuellen Alignment vor allem die Eingabe von Zeit, Zeitzone und Koordinaten des Standorts (Länge und Breite) lästig. Wenns schlecht läuft muss man das gleich mehrmals machen, ehe ein vernünftiges Alignment zustande kommt. Daher nutze ich gerne die WiFi-Steuerung über das Smartphone, dabei werden diese Daten automatisch eingegeben. Die Motorensteuerung ist am Smartphone leider nicht ganz so komfortabel zu machen wie an der Handbedienung, aber bislang fahre ich damit besser. Am Besten erprobt man das ganze Alignment tagsüber, mit drei definierten Zielen (es muss ja nicht unbedingt das Fenster des Nachbarn sein) im Blick des häuslichen Balkons oder draußen im Gelände. Dabei kann auch die Steuerung der Motoren mit unterschiedlichen Geschwindigkeit geübt werden. Die hohen Geschwindigkeiten sind erstaunlich schnell, die niedrigen extrem langsam, nahe am Stillstand. Damit sollte man sich vertraut machen. Beim Richtungswechsel passiert oft erst einmal gar nichts, bis das Getriebespiel eingeholt ist.
5.13 Steifer Nacken, kalte Füße
Kopfschmerzen nach langen Beobachtungen sind oft auf
schlechte Haltung, Verspannungen im Nacken und dergleichen
zurückzuführen. Daher sollten wir immer auf die
Körperhaltung achten am Fernglas oder Teleskop,
Entspannungs- und Dehnungsübungen einbauen, technische
Hilfsmittel wie Winkelprismen nutzen, um nicht mit
verdrehtem Kopf durchs Okular schauen zu müssen. Die Höhe
des Stativs ist auf eine entspannte Haltung hin
einzustellen, Hocker und Trittleitern helfen bei Dobsons,
die richtige Einblickhöhe zu finden. Bei längeren
Sondierungen mit dem Fernglas bringen Sessel mit
Nackenstütze oder die "Karpfenliegen" der Angler
hervorragende Entlastung. Und diese bringen auch eine ganz
besondere Erfahrung des Sternenhimmels mit sich, die viele
seit der Kindheit nicht mehr gemacht haben: auf dem Rücken
liegend in die Sterne zu schauen! Auch hartgesottene
Galaxienjäger können sich dabei hervorragend entspannen.TIPP: AUF DIE GESUNDHEIT ACHTEN BEIM BEOBACHTEN!
Im Winterhalbjahr bietet der Sternenhimmel besondere Feinheiten für Amateurastronomen, alleine schon durch die längeren Nächte. Allerdings macht das nur Spaß, wenn man bereits gut eingearbeitet ist. Sonst verbringt man viel Zeit mit Gefummele und holt sich rasch eine Erkältung, wenn man nach dem Gefummele dann auch unbedingt was sehen möchte, obwohl man schon durchgefroren ist. In jedem Falle lieber eine Jacke und Thermohose zuviel einpacken als zu wenig. Ich habe gelernt, dass vor allem warme Schuhe und Strümpfe im Winterhalbjahr wichtig sind. Wir stehen stundelang fasziniert, schauen, suchen, sind beschäftigt - und merken erst zuhause, dass unsere Füße durchgefroren sind. Astronomie ist nicht gerade ein Bewegungssport, davon wird einem nicht wirklich warm.
Hilfreich ist auch ein oben offenes Beobachtungszelt, das ist mobil, wiegt wenig, ist schnell aufgeschlagen. Die gibt es schon unter 200 Euro, etwa die "Omegon Zeltsternwarte". Solch ein Rundzelt hält den Wind ab (tut auch der Beobachtungsqualität gut, weniger Vibrationen) und kann bei einem Regenschauer schnell oben geschlossen werden. Eine Zeltheizung ist zumindest für die Beine möglich - muss aber so aufgestellt werden, dass keine Warmluft um den Tubus wabert und zu optischen Verzerrungen führt! Also gegen die Windrichtung und hinter dem Tubus. Und die volle Thermoskanne sollte auch nicht fehlen! Und ein Schal um den Hals!
Und wenns ganz frostig kommt (und du unbedingt raus willst): Moon Boots und Gefrierhaus-Overall/Thermooverall! Und die Hände nicht vergessen. Gerade beim Fernglaseinsatz sind die besonders gefährdet dadurch, dass sie oft nach oben gehalten werden und das kalte Glas anfassen. Thermohandschuhe mit Wärmepads haben sich bei mir nicht bewährt und auch von anderen höre ich eher Skepsis, sofern man nicht gerade bei arktischen Temperaturen rausgeht. Zwei Schichten (dünnerer Fingerhandschuh und darüber Fäustling) können Sinn machen, bedeuten aber zusätzliches Material und Gefummele.
6
Orientierungshilfen
Es mag banal klingen, aber die Orientierung am Himmel hat mit der Orientierung "unten" wenig zu tun und wir müssen uns dies immer wieder bewusst machen! "Unten" bleibt alles an seinem Platz, der Kirchturm steht von meinem Fenster aus immer links von der Burg, der Fernsehturm Stuttgart steht genau südlich vom Kernerplatz. Aber "oben" am Sternhimmel ist ein beständiges Drehen und Wandern. Nur die Positionen zueinander bleiben gleich, das Gesamtgewebe - mal abgesehen von den "Wandersternen", den Planeten, dem Mond und einigen flüchtigen Objekten.
Zur Orientierung am Nachthimmel und um ein Gefühl für den "Ort" zu bekommen, durch den man als AstronomIn streift, ist es daher unverzichtbar, eine eigene mentale Karte des Himmels zu entwerfen. Dabei wird jeder ein wenig anders verfahren, wichtige Hilfsmittel sind Sternkarten (die drehbare von Kosmos z.B.) und einschlägige Apps (ich kann Sky Guide und Sky Safari empfehlen). Ich stelle hier ein Modell - ausdrücklich nur beispielhaft! - für Einsteiger vor, das auf 6 offenen Sternhaufen, 20 Sternen und 12 Sternbildern basiert, die am Märzhimmel gut in der ersten Nachthälfte zu sehen sind. Die Orientierungsschulung ist auf Objekte angewiesen, die wir auch mit bloßem Auge auffinden können. Hilfreich für das Erstellen der "Mental Map" ist ein ordentliches Fernglas mit einer Vergrößerung zwischen 6- und 10-fach (darüber wird das Bild für die meisten Nutzer ohne Auflegen verwackelt und das Sehfeld zu eng), einem Objektivdurchmesser ab 30mm, einem weiten Sehfeld und einem Gewicht von maximal 900 Gramm.
Ich beginne mit den Sternhaufen, da sie gut aufzufinden sind, schon im Fernglas Sehvergnügen bereiten und Lust auf mehr Astronomie machen. Meine sechs zu merkenden Sternhaufen sind, von Ost nach West gesehen, der Coma-Berenices-Haufen (Melotte 111), der Bienenstock-Haufen (M 67), die Hyaden (Melotte 25/Collinder 50), die Plejaden (M 45), der Perseus-Haufen (Melotte 20/Collinder 39) und, last and least, Collinder 464 in der Giraffe.
20 Sterne schlage ich vor zum Aufbau des inneren Sternenhimmels. Ausgewählt habe ich sie zunächst einmal nach ihrer scheinbaren Helligkeit, wir sollen sie schließlich auch mit bloßem Auge erkennen können. Geordnet nach ihrer Position in der Liste der hellsten Sterne sind es: Sirius (1), Arcturus (3), Wega/Vega (5), Capella (6), Rigel (7), Prokyon/Procyon (8), Beteigeuze/Betelgeuse (9), Altair (12), Aldebaran (14), Spica (15), Antares (16), Pollux (17), Deneb (20), Regulus (22), Castor (24), Mirfak (35), Alhena/Almeisan (44), Polaris (47), Alpheratz (55), Mirach (57). Es fehlen die Sterne, die wir am Nordhimmel nicht zu sehen bekommen. Und es fehlen viele, die später mit der Erfahrung sukzessive dazu kommen. Jeder Himmelsbeobachter wird etwas andere Akzente setzen, abhängig von den eigenen Erfahrungen und Sehgewohnheiten - und natürlich auch von der Beobachtungszeit!
88 offiziell anerkannte Sternbilder gibt es, auf die sich die Mitglieder der Internationalen Astronomischen Union 1922 geeinigt haben. Die meisten Leute nennen auf Anhieb den Kleinen und den Großen Wagen, die aber nicht einmal zu dieser Liste gehören, sondern nur in ihrer weiteren Gestalt als Kleiner und Großer Bär Aufnahme gefunden haben. Orion dürfte auch noch vielen geläufig sein, dann ist aber meist schon Schluss. Zur Erstellung einer Mental Map des (nördlichen) Sternenhimmels halte ich 12 Sternbilder für besonders hilfreich, da sie gut identifizierbar sind, in einem geschlossenen (Frühjahrs-)Band liegen und zahlreiche Absprunghilfen bieten: Orion, Taurus/Stier, Auriga/Fuhrmann, Andromeda, Kassiopeia, Kleiner Bär, Großer Bär, Bootes/Bärenhüter/Rinderhüter (gr. "bootes" - der mit den Stieren pflügt), Löwe, Kleiner Hund, Zwillinge, Großer Hund. Mit dem Großen Hund schließt sich der Gürtel zu Orion. Dazu kommen im Sommer sinnvollerweise Adler, Lyra und Skorpion, im Herbst Schwan, Pegasus und Fische. Auch hier gilt: Letztlich entscheiden die eigenen Erfahrungen und Interessen über die Auswahl.
Für die Feinorientierung ist es hilfreich, auf geometrische Strukturen am Himmel zu achten. Um diese sinnvoll einsetzen zu können, benötigen wir jedoch die Groborientierung über Sternhaufen, Sterne und Sternbilder. Die verschiedenen Orientierungshilfen ergänzen und stärken einander.
6.1 Orientierung an Sternhaufen
Die Plejaden sind der bekannteste und markanteste Haufen, der vor allem durch sechs in Form einer flachen Tasse oder eines alten Korbkinderwagens angeordnete helle Sterne auffällt und der schon in menschlicher Frühzeit wahrgenommen und mit Mythen umrankt wurde. Richtung West (am Märzhimmel) kommen wir von ihnen zum Alpha-Persei-Cluster (Perseus-Haufen) - und auf dem halben Weg können wir mit geeignetem Filter Ausschau halten nach dem Kaliforniennebel.In entgegengesetzter Richtung liegen die Hyaden, die in Mythen der Tuareg und in der antiken Mythologie eng mit den Plejaden verbunden sind. Sie wurden von den Römern als Ferkelherde angesehen, deren Hirt Aldebaran sei. Allerdings gehört der markante Stern Aldebaran nicht zu den Hyaden, er steht wesentlich näher bei uns als der Sternhaufen. Nahe bei den Hyaden liegt das Sternbild Orion mit einigen wichtigen Nebelformationen, wovon vor allem der Orion-Nebel und der Pferdekopfnebel bekannt sind, und zwei markanten Sternen, Beteigeuze und Rigel.
TIPP: BEGINNEN SIE ZUR ORIENTIERUNG MIT DEN MARKANTEN STERNHAUFEN!
Östlich der Hyaden finden wir einen mythologisch gleichfalls sehr bedeutenden Sternhaufen, den Bienenstock-Haufen, auch Futterkrippe/Praesepe genannt. Markiert ist er durch zwei Sterne, die nicht zu ihm gehören, Asellus Borealis und Asellus Australis, dem Sternbild Krebs zugehörig, die zwei "Esel" des Dionysos, die an der "Krippe" auf alle Zeiten fressen. Und noch weiter östlich stoßen wir, ausgehend vom Sternbild Löwe, auf den Coma-Berenices-Haufen, der uns ein interessantes Galaxiengebiet erschließt, in den Sternbildern Jagdhunde, Haar der Berenike/Coma Berenice und Jungfrau.
Zwischen dem Coma-Berenices-Cluster und dem Persei-Cluster liegt ein Bereich ohne bekannte Sternhaufen, mit Ausnahme des unspektakulären Haufens Collinder 464 im gleichfalls unspektakulären Sternbild Giraffe, der fürs bloße Auge wenig hergibt. Schon das Fernglas zeigt dann allerdings eine prägnante Farbigkeit seiner Mitglieder, mit Blau- und Rottönen. Er liegt auf einer Linie zwischen Polaris und Capella, etwa 1/3 Weges von Polaris entfernt.
6.2 Orientierung an Sternen
Wichtigstes Orientierungsmerkmal ist die Helligkeit der Sterne, und zwar die scheinbare Helligkeit für uns, die Visual Magnitude, kurz VM, Einheitskürzel "mag". Der höchste Wert gibt dabei die geringste Helligkeit an, umgekehrt sind negative Werte ein Indikator großer Helligkeit, die Sonne etwa hat den Wert -26.7 mag.Der hellste Stern am Nachthimmel ist Sirius im Sternbild Großer Hund (-1). Gehen wir von Sirius aus (Anfang März in der ersten Nachthälfte wohlgemerkt) nach Westen, stoßen wir auf Beteigeuze (+0.56) und Rigel (+0.28), die das Sternbild Orion begrenzen. Zwischen Beteigeuze und Pollux steht Alhena/Almeisan als einer der Zwillingsfüße. Richtung Orion erstreckt sich von hier aus ein wichtiges Nebelgebiet. Aldebaran westlich von Beteigeuze markiert die Hyaden, über ihm steht die strahlende Capella (+0.07) im Sternbild Fuhrmann/Auriga.
Danach wird es etwas dunkler Richtung West. Mirfak (+1.8) im Sternbild Perseus, Mirach im Sternbild Andromeda und Polaris als erster Deichselstern des Kleinen Wagens fallen hier trotz ihrer geringeren Leuchtkraft in den Blick. Südwestlich vom Mirach liegt Alpheratz, oberster Stern des Herbstvierecks im Sternbild Pegasus, das mit Fischen und Andromeda ein markantes Sternbilddreieck bildet, welches geprägt ist durch lineare Strukturen. Deneb, Wega und Altair bilden weiter westlich das dann wieder leuchtstärkere Sommerdreieck (sehr gut zu sehen allerdings z.B. auch in den frühen Morgenstunden im März). Deneb im Sternbild Schwan führt uns zu einem wichtigen Nebelgebiet, Wega im Sternbild Lyra/Leier ist dank seiner Leuchtkraft (+0.03) einer der wichtigsten Sterne zur Groborientierung und Altair (+0.93) im Sternbild Adler führt uns mit dem einiges dunkleren Sabik (Sternbild Schlangenträger, +2.43) zu zahlreichen Nebeln und Kugelsternhaufen.
TIPP: HALTEN SIE AUSSCHAU NACH DEN HELLSTEN STERNEN IN IHRER JEWEILIGEN UMGEBUNG!
Mit Arcturus (+0.15) im Sternbild Bärenhüter/Bootes erreichen wir die Grenze zu einem wichtigen Sternhaufen- und Galaxiengebiet. Der spektakuläre Kugelsternhaufen M3 steht direkt über ihm. In seiner Nähe erstrecken sich die Galaxiengebiete der Sternbilder Jagdhunde, Haar der Berenike/Coma Berenices und Jungfrau/Virgo. Den südlichen Abschluss des Galaxienbandes markiert die bläulich leuchtende Spica im Sternbild Jungfrau. Südlich von Arcturus und Spica zeigt sich im Sommer Antares mit seinem Sternbild Skorpion, der ein interessantes Nebel- und Cluster-Gebiet erschließt. Nordöstlich von Spica leuchtet Regulus, ein Eckstern im augenfälligen Sternbild Löwe, ein weiteres besonders für Anfänger wichtiges Galaxiengebiet.
In Richtung Pollux stoßen wir auf das Beehive-/Praesepe-Cluster. Bei Pollux steht Castor als zweiter der Zwillingssterne. Südlich von ihnen steht Prokyon/Procyon im Sternbild Kleiner Hund. Und damit schließt sich das frühlingshafte Sternenband wieder zu Sirius.
Im Sommer führt uns der gelbrot glühende Antares (Skorpion) zu einer ganzen Fülle an Nebelgebilden, Kugelsternhaufen, offenen Sternhaufen in unmittelbarer Nähe und in Richtung Osten über das auffallende Ophiucus-Knie (in anderen Darstellungen rechter Ophiucus-Fuß) um den bläulichen Stern Theta Ophiuchi/42 Oph zum reichhaltigen Objekte-Gebiet zwischen Lagunen-Nebel und dem kleinen gelblichen Sternhaufen NGC 6604.
Achten Sie auch auf die Farbigkeit der Sterne. Bläulich und gelb-rötlich schimmernde Sterne bieten wichtige Markierungspunkte und bei Verwechslungsgefahr/Unsicherheit hilft uns oft, die Farbe zur Vergewisserung einzubeziehen.
Unterstützend zur Einprägung der Sterne kann es sein, sie paarweise zu ordnen - möglichst über Sternbildgrenzen hinweg. Also etwa: Wega-Arcturus, Spica-Regulus, Sirius-Prokyon, Pollux-Beteigeuze, Rigel-Aldebaran, Capella-Mirfak und so fort. Abhängig von Standort, Jahreszeit, Uhrzeit und immer orientiert an dem, was man oben am Himmel wirklich und persönlich und wiederholt in einer Verbindung "sieht".
Hilfreich ist es auch, sich ein charakteristisches Muster des Sternes mit seiner Umgebung zu merken, das wir in verschiedenen Ausrichtungen identifizieren können. Nachfolgend ein Beispiel, wie die charakteristische Positionierung eines Sternes sich im Laufe des Jahres im Uhrzeigersinn verschiebt/dreht (Arcturus - mit Sommerzeit):
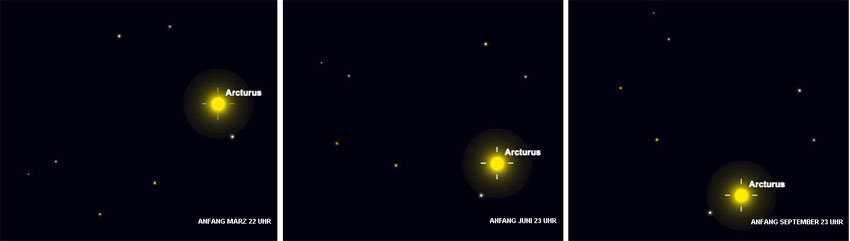
6.3 Orientierung an Sternbildern
Orion, gut sichtbar von August bis April, vor Mitternacht erst ab Oktober, ein Winterbild, liegt in Nachbarschaft des Plejaden-Haufens und stellt ähnlich wie die Plejaden ein besonderes Schmuckstück des Sternenhimmels dar, schon für das bloße Auge. Er versammelt zwei markante Sterne, den roten Überriesen Beteigeuze und den bläulich schimmernden Mehrfachstern Rigel. Dazu liegt in seiner unteren Hälfte der schon mit bloßem Auge diffus wahrnehmbare Orion-Nebel und um seinen blauen Gürtelstern Alnitak liegen bekannte Nebelformationen wie der Weihnachtsbaumnebel und der Pferdekopfnebel. In der Nähe von Alnitak, Richtung Kleiner Hund, spannt sich der riesige Nebel Barnard's Loop.Gleich neben Orion finden wir Taurus, den Stier, und Auriga, den Fuhrmann, ersterer prägnant durch sein Y, letzterer durch sein Fünfeck. Der Stier führt uns zum farbenprächtigen Cluster Collinder 65. Im Fünfeck des Fuhrmanns versammeln sich einige (im Teleskop) bildstarke Sternhaufen, darunter Pinwheel (M36) und Starfish (M38), und einige Nebel. Das Sternbild Andromeda zeigt uns den Weg zur Andromeda-Galaxie. Wir starten von Mirach, folgen der Linie über My And und Ny And und landen unweigerlich bei der schon mit bloßem Auge in einigermaßen dunklem Himmel erkennbaren Galaxie. Orientierung kann auch die weiter westlich liegende Formation Kassiopeia mit ihrem charakteristischen Haken-Z/oben aufgeklapptem Sigma bieten, das über das ganze Jahr hinweg gut zu sehen ist. Kassiopeia liegt umgeben von zahllosen Clustern und Nebelformationen, von denen das Double-Cluster und das Eulen-Cluster sowie der Herz- und der Seelennebel unbedingt Besuche lohnen.
TIPP: SUCHEN SIE IMMER WIEDER DIE STERNBILDER AUF, DIE SIE SICH GUT MERKEN KÖNNEN!
Weiter gehts zum Kleinen und zum Großen Bären. Der Kleine Wagen als Teil des Kleinen Bären ist für die Amateurastronomie bedeutsam durch seinen vordersten Deichselstern, Polaris, der als Peilstern für äquatoriale/parallaktische Montierungen genutzt wird. Der mittlere Deichselstern des Großen Wagens als Teil des Großen Bären ist ein interessanter Mehrfachstern, Mizar. Beim Großen Bären hin zu Polaris finden wir die beiden Bode-Galaxien, M81 und M82. Zwischen der Deichsel des Großen Wagens und dem Sternbild Rabe/Corvus erstreckt sich am Bärenhüter/Rinderhirten/Bootes vorbei ein langes Band von Galaxien, das sich durch die Sternbilder Jagdhunde, Haar der Berenike und den Oberkörper der Jungfrau zieht, anfangend mit der Strudelgalaxie/Whirlpool-Galaxie (M51) bei der Deichsel und endend mit der Sombrero-Galaxie (M104) beim Raben. Zwischen Bootes und Coma Berenices liegt der famose Kugelsternhaufen M3.
Allerdings müssen wir damit umgehen lernen, dass die Sternbilder in immer wieder anderen Positionen am Himmel stehen. Die zirkumpolaren Sternbilder wie der Kleine und der Große Bär wandern im Laufe von 24 Stunden einmal im Kreis um den Polarstern, wir sehen am Wagen also die Deichsel mal nach links, mal nach rechts, mal nach unten, mal nach oben!
Am Bauch des Löwen hängen einige Galaxien, die schon mit Öffnungen ab 200mm/8'' lohnend zu studieren sind. Canis Minor, der Kleine Hund, ist sehr gut zu identifizieren und er führt uns zu einem stattlichen Bündel an Nebeln und Clustern, die zwischen ihm und Beteigeuze liegen. Die Zwillinge sind durch ihre markanten Sterne Castor, Pollux und Alhena gut auszumachen. Zwischen ihnen und dem Kleinen Hund liegen der Eskimo-Nebel und der Medusa-Nebel. Der Große Hund mit seinem markanten Leitstern Sirius beheimatet in seinen Umrissen zahlreiche Cluster und einige Galaxien.
Ein schönes Sommervergnügen mit dem Fernglas sind die kleinen Sternbilder Delphin ("Job's Coffin"), Pfeil und der Sternhaufen Kleiderbügel/Coathanger/Brocchi-Haufen/Al Sufi's Cluster/Cr399, die wir vom markanten Sternbild Adler, genauer von dessen prächtiger Trias-Linie Alshain, Altair und Tarazed (rotgelb funkelnd) aus gut finden. Und der Hantelnebel M27 ist dort auch gleich in der Nähe!
Nehmen Sie sich die Freiheit, selbst Gegenstände oder andere Bilder am Himmel zu sehen. Machen Sie den Himmelsanblick zu Ihrem Himmel, mit Ihren "Sternbildern". Für mich ist der Kleine Hund ein Schürhaken und der Delphin mal eine Fliegende Suppenschüssel, mal ein Sternentor.
6.4 Orientierung an Asterismen
Asterismen nenne ich hier Sternbilder und Sterngefüge ohne
offiziellen Status als Sternbild, die unsere kreative
Wahrnehmung zu einem bildhaften Gefüge zusammenfasst. Das
griechische Wort "asterismos" bedeutet schlicht
"Sterngruppe", insofern sind auch Sternbilder letztlich
Asterismen - und derart allgemein, übergreifend wird die
Bezeichung auch gerne verwendet. Der Unterschied zu
Sternbildern ist ein akzidentieller, historisch begründet.
Andere Kulturen kennen andere Sternbilder, die wir entweder
gar nicht wahrnehmen oder unter anderem Namen. Einer der
bekanntesten Asterismen ist der wunderschöne Kleiderbügel
beim Sternbild Pfeil. Auch der Große und der Kleine Wagen
sind letztlich "nur" Asterismen, die offiziellen
Sternbilder, denen sie zugehören, sind Großer und Kleiner
Bär.Auffallend sind auch die Kaskaden, lange Ketten von Sternen, die zu den üblichen Beobachtungszeiten von oben nach unten zu fallen scheinen, eben wie Wasserkaskaden, Wasserfälle. Die bekannteste und auch so benannte ist "Kembles Kaskade" im Sternbild Giraffe. Mir persönlich wichtig ist auch die Kette bei Castor und Pollux, im Sternbild Krebs, in Richtung M34, des offenen Sternhaufens mit den Namen Bienenkorb oder Futterkrippe. Sie geht aus von Omega1 Cancri und erstreckt sich über eine bunte Reihe gelb bis rot gefärbter Sterne, bis sie anschaulich vertröpfelt.
Eine weitere besondere Gruppe sind die Jahreszeitenkonstellationen. Das Frühlingsdreieck wird gebildet durch Arktus (Bärenhüter), Spica (Jungfrau) und Regulus (Löwe). Das Sommerdreieck besteht aus Wega (Leier), Deneb (Schwan) und Altair (Ader). Der Herbsthimmel wird markiert durch das Herbstviereck aus Algenib, Markab und Scheat (alle Pegasus) sowie Alpheratz (früher Pegasus, heute Andromeda). Im Winter kann man sich am Winterdreieck Sirius (Großer Hund), Prokyon (Kleiner Hund), Beteigeuze (Orion) orientieren oder am Wintersechseck aus Capella, Aldebaran, Rigel, Sirius, Prokyon und Pollux.
"Entdecken" Sie auch Ihre eigenen Sternkonstellationen, die noch keinen Namen haben, der Himmel ist voller Pyramiden, Koffern, Ketten, Schriftzeichen, Symbolbildern - Ihren persönlichen!
6.5 Orientierung an geometrischen Figuren
Sternhaufen, helle Sterne und Sternbilder helfen bei der
Groborientierung. Zur Feinorientierung benötigen wir
jedoch noch ein weiteres Handwerkszeug, die geometrischen
Figuren. Dabei dürfen wir uns zunächst leiten lassen von
dem, was wir persönlich an Mustern am Sternhimmel
"erkennen". Der eine sieht überall Kreise und Bögen, die
andere sieht Sterngruppen und der dritte Dreiecke.
Gemeinsam ist uns allen die Fähigkeit (und Neigung) zur
Mustererkennung. So arbeitet unser Gehirn. Achten Sie auf
Ihre persönlichen Wahrnehmungsmuster, machen Sie sich
diese bewusst! Wenn Sie diese Muster dann auf einer App
suchen, um ein Objekt aufzufinden, kann es hilfreich sein,
die Markierungslinien der Sternbilder abzustellen, um von
diesen nicht abgelenkt zu werden. Wichtig ist es auch, auf
der App die Sternensichtbarkeit etwa so einzustellen, wie
wir sie gerade mit unseren Augen oder dem Hilfsmittel
Fernglas/Sucher haben. Sonst wird es schwierig, den
Anblick auf der App mit dem am Himmel in Deckung zu
bringen.
Die einfachste geometrische Figur ist der Punkt.
Wir kennen sie schon von den hellen Sternen. Schwächer
leuchtende Sterne werden markant, wenn sie zu zweit oder
zu dritt zusammenstehen. Ob wir dann zwei/drei Sterne oder
eine Linie/ein Dreieck sehen, hängt von unseren
Sehgewohnheiten und Wahrnehmungsstrukturen sowie
objektiven Faktoren ab. Besonders markant sind zwei helle
Sterne, die zusammen stehen, wie Castor und Pollux
(Zwillinge), Hamal und Sheratan (Widder), oder die beiden
Jagdhunde. Weit weniger auffallende Sternpaare
umringen den Kaliforniennebel, wir können sie schon gut
bei 10facher Vergrößerung wahrnehmen (die auch für den
Kaliforniennebel sinnvoll ist). Sie zeigen uns, wo wir ihn
sehen könnten - sähen wir ihn denn. Optische Sternpaare
bieten ausgezeichnete Treppenstufen zur Annäherung an ein
Objekt.
TIPP: ACHTEN SIE DARAUF, WELCHE MUSTER IHNEN
PERSÖNLICH AUFFALLEN!
Ob drei beieinander stehende Sterne, deren Anordnung
signifikant von der Linie abweicht, als Dreieck, Winkel,
Keil oder Bogen wahrgenommen werden, hängt
von vielen Faktoren ab, objektiven (Positionen,
Helligkeitsgrade, Zwischensterne) wie subjektiven
(Sehgewohnheiten, Blickwinkel, Vorlieben, Erfahrungen).
Das Kleine-Hund-Dreieck Gomeisa-Gamma Canis
Minoris-Epsilon Canis Minoris war eines der ersten
Dreiecke, die mir aufgefallen sind - ich habe es jedoch
nie als Dreieck gesehen, sondern als Winkel eines
Schürhakens, dessen Griffende Prokyon/Alpha Canis Minoris
markiert. Markante Dreiecke haben wir z.B. in den
Sternbildern Haar der Berenike, Sextant und
Dreieck/Triangulum (sic). Kleinere Dreiecke können uns
sehr dabei helfen, den Betrachtungsraum zu gliedern. Die
Annäherung an das Leo-Triplett gelingt z.B. vorzüglich
über HD98388-HD98354-73Leo.
Linien prägen etwa die Sternbilder Fische,
Giraffe, Perseus, Skorpion und Stier. Ob wir die
gewundenen Linien von Luchs, Schlange, Wassermann oder
Wasserschlange wahrnehmen, hängt sicher entscheidend auch
von unserer Schulung und unserem Wissen ab. Bögen
als Sonderfall der Linie prägen z.B. das Sternbild
Nördliche Krone. Wer Bögen zu sehen vermag, hat damit eine
gute Aufsuchhilfe etwa für die Galaxien im Virgo-Haufen,
so liegt M58 im Bogen
TYC0878/0572/1-BD+122498-HD109771-HD109763. Ein anderes
Beispiel: Der Stern Beta Trianguli ist durch den
4-Sterne-Bogen von BD +34390 über 2x TYC bis SAO 55313
eindeutig zu identifizieren und wir können uns von ihm
ausgehend den Andromeda-Cluster, die Dreiecksgalaxie und
die Andromeda-Galaxie erschließen. Sind Linien oder Bögen
unregelmäßig, wird auch von Ketten gesprochen.
Besonders schön ist Kembles Kaskade in der Giraffe.
Ein wichtiges geometrisches Element am Sternhimmel ist
das Viereck, das häufig auch in Sternbildern
musterbildend auftaucht, so im Großen und im Kleinen
Wagen/Bären, bei Leier, Herkules, Pegasus und Rabe. Oft
machen wir beim Sehen aus einem im Sternbild gemeinten
Vieleck ein Viereck, indem wir Zwischensterne ignorieren.
Besonders aufmerksam sind wir bei Romben und Trapezen -
diese können wertvolle Peilhilfen sein. In der Regel
können Vierecke auch als Vielecke gesehen werden, da es
"passende" Zwischen- oder Randsterne gibt.
Sind Vielecke besonders groß oder verzogen,
reduzieren wir sie eher nicht auf Vierecke. Wir "sehen"
sie vielmehr als Vielecke, was eine besonders spannende
Seherfahrung ist - etwa beim Bärenhüter/Bootes, beim
Fuhrmann/Auriga, beim Löwen und bei den Zwillingen.
Manches Mal sehen wir sie auch im Wechsel mit einem
Viereck, als Kippbilder gleichsam, je nach Fokus und
Seherwartung.
Weitere prägnante Muster im Großen wie im Kleine sind Kreuze
(Sternbild Schwan) oder Buchstaben (das offene
Sigma/breitgezogene W von Kassiopeia). Eine hilfreiche
Vorstellung ist auch die Verbindung von Kimme und Korn,
zwei markante Sterne, durch die wir über einen dritten ein
Ziel anpeilen können.
Sehr persönlich wird es bei Figuren, ich sehe
z.B. die markanten Sterne des Kleinen Hundes als
Schürhaken, Suppenschüsseln sehe ich beim Delphin und in
den Hyaden bei Aldebaran. Barrenformen machen mir Auriga
(mit den Auriga-Sternen 16 bis 19) und den Rosetten-Nebel
zugänglicher.
Zentrales Stichwort bei unserer orientierenden
Musterbildung ist "Komplexitätsreduktion". Den größten
Teil der sichtbaren Sterne blenden wir dabei aus, um nicht
in der Fülle verloren zu gehen. Wir konzentrieren uns auf
einige wenige hellere und/oder durch ihr Stellung
zueinander und zu unserem gesuchten Ziel markante Sterne.
Markante Sterne und Formen helfen vor allem beim
erschwerten Starhopping mit Filtern.
Zum nachfolgenden 7. Kapitel habe ich "GoTo-Grafiken"
angefügt, die diese Komplexitätsreduktion zur
Musterbildung als Auffindehilfen sinnfällig machen.
7 Aufsuchwege,
Aufsuchhilfen, Aufsuchtipps - Starhopping
Trotz aller Anfänger-Verzweiflung beim Aufsuchen von
Objekten: Anders als bei der Nadel im Heuhaufen wissen wir
bei den Himmelsobjekten sehr wohl, wo sie sich befinden. Es
gibt sogar exakte Koordinaten, die wir an einer gehobenen
Teleskop-Ausstattung einstellen und ansteuern können. Und es
gibt die GoTo-Steuerungen. Es gibt aber auch das Bedürfnis,
sich selbst zu orientieren. Wie ja die meisten von uns bei
einer Wanderung ungern nur der Stimme eines
Navigationsgerätes folgen wollen. Wobei der Himmel kein
Schwarzwald ist und schwierigere Objekte sicherlich
Navigationshilfen benötigen.Zur eigenen Orientierung haben wir Sternenkarten oder Planetariums-Apps, auf denen wir die Standorte unserer gesuchten Objekte - unserer "Wanderziele" - aufsuchen können. Wir sehen dort, wo und in welchen markanten Nachbarschaften am Himmel die Objekte sich befinden (sofern das Zoom unserer App es zulässt). Und von diesen Nachbarschaften, diesen "Claim Sticks" aus können wir uns vortasten zu unseren Wunschzielen mit einer Technik, die auch als "Starhopping" bezeichnet wird.
Unabdingbar als Aufsuchhilfe ist ein Fernglas, mit dem wir einen Weg aufspüren, den wir dann mit dem Suchfernrohr nachgehen können. Zu empfehlen sind Vergrößerungen zwischen 7- und 15-fach, Öffnungen zwischen 40mm und 70mm - bei Werten darüber hinaus wirds wackelig im Bild bzw. schwer zu halten für den Orientierungsblick. Gundsätzlich kann auch ein Stativ hilfreich werden bei einiger Übung. Damit kommen wir bei den nachfolgend angesprochenen Sternhaufen und vielen Nebeln gut voran. Bei Galaxien reicht uns ein Fernglas nur für einige näher liegende Exemplare zur Wahrnehmung als Helligkeitsfleck.
Alle Aufsuchwege sind nur als Vorschläge anzusehen. Jeder hat seine eigene Wahrnehmung von Strukturen, die er sich merken kann, jede Beobachtung hat etwas andere Bedingungen. Daher kann es auch sinnvoll sein, je nach Bedingungen unterschiedliche Aufsuchwege auszuprobieren.
Bei den Sternnummern orientiere ich mich an Sky Safari. Starry Night z.B. verwendet teilweise andere Kataloge. Hier geht es direkt zu meinen Aufsuchkarten für ausgewählte Fernglasobjekte.
7.1 Wie finde ich interessante Sternhaufen?
Sternhaufen der Milchstraße sind relativ einfach
aufzufinden, da sie, wie der Name schon vermuten lässt,
größere Gebilde sind. Und gerade wegen ihrer größeren
Ausdehnung machen sie sich im Fernglas häufig optisch
besser als im Teleskop, da wir sie damit gut überblicken
können und in ihr Umfeld eingebettet sehen.
Den bekanntesten und eindrücklichsten Sternhaufen, die Plejaden
(M45), können wir im Winterhalbjahr deutlich sehen
im Sternbild Stier, zwischen Aldebaran und Mirach,
1/4-wegs von Aldebaran.
Die Hyaden (Cal 41) befinden sich von den
Plejaden Richtung Orion beim Stern Aldebaran. Auch sie
können wir mit bloßem Auge erkennen.
Im Zentrum des Dreiecks Beteigeuze-Prokyon-Alhena steht
der Weihnachtsbaum-Haufen (NGC 2264)/Christmas
Tree Cluster. Als Weihnachtsbaum zeigt er sich (wie auch
der Weihnachtsbaum-Nebel) aufrecht nur in
Spiegelteleskopen - mit Fernglas, Refraktor oder
Amici-Prisma steht er - als Weihnachtsbaum - auf dem Kopf.
Er benötigt schon eine Vergrößerung, um sichtbar zu
werden.
Etwas deutlicher ist dann wieder der Bienenkorb-Haufen
(M44)/Beehive Cluster/Praesepe/Futterkrippe zu
erkennen. Dieser beliebte Haufen hebt sich allerdings
nicht so prägnant von seinem Umfeld ab wie die Plejaden
oder die Hyaden. Er ist dennoch einfach aufzuspüren in der
Nähe von Leo durch seine Position zwischen Regulus (Stier)
und Pollux (Zwillinge), nahe bei den Sternen Asellus
Australis und Asellus Borealis im Sternbild Krebs. Wir
finden ihn auch auf der Mittelsenkrechten der Strecke
Regulus-Alkaid, 1/5 streckenwegs zur Seite von Arcturus.
Etwas weiter vom Löwen entfernt stehen die kleineren
Haufen M46 und M47 im Sternbild Puppis/Achterdeck. Einige
helle Sterne von M47 sind auch mit dem Fernglas
schon zu sehen. Kompakt und reichhaltig, aber einiges
dunkler ist der Sternhaufen M46 gleich daneben. Ab
8'' zeigt dieser bei geringer Vergrößerung einen Teppich
farbenprächtig strahlender Sterne.
Auf der anderen Seite des Sternbilds Löwe kommen wir zum
Berenike-Haufen (Mel 111)/Coma Berenices
Cluster im Sternbild Coma Berenices. Der ähnlich gut wie
der Bienenkorb-Haufen erkennbare Haufen liegt halbwegs
zwischen Denebola (Löwe) und Cor Caroli (Jagdhunde).
In einem eher leeren Umfeld zeigt sich dann der bezüglich
seiner Sichtbarkeit dem Weihnachtsbaum-Haufen
vergleichbare bunte Haufen Collinder 464 im
Sternbild Giraffe. Er liegt auf der Strecke
Polaris-Capella, 1/3-wegs von Polaris.
Wieder auf dem Sichtbarkeitsniveau der Hyaden liegt der Perseus-Haufen
(Mel 20)/Alpha-Persei-Cluster im Sternbild Perseus.
Er gruppiert sich um den hellen Stern Mirfak/Alpha Persei.
In seiner Nähe, hin zu Kassiopeia, liegt der einzige
bekannte Doppelsternhaufen unserer Milchstraße, Ha-Chi-Persei.
Trotz seiner großen Entfernung von 6.800/7.600 Lichtjahren
ist er leicht aufzufinden und gut im Fernglas zu
betrachten. Von ihm aus kommen wir zum Eulen-Haufen
(NGC 457) beim Kassiopeia-Stern Ruchbah ("Knie"). Manche
nennen ihn anspielungsreich auch "E.T." - wie ein
geheimnisvolles Alien schwebt er, großäugig, im Raum. Für
mich ist es allerdings "s'Geistle".
Im Sommer klar zu sehen ist auch mit einem mittleren Glas
der Wildentenhaufen (M11). Besonders markante
Ausgangspunkte können Altair sein oder Antares. Wir finden
M11 neben dem "Kasten" aus HR 7083, R Scuti/Schild, HD
173744 und HD 174005. In diesem liegt ein etwas
schwierigerer, lichtschwacher Haufen, Basel 1.
Dabei gelangen wir zuerst zu Messier 3. Diesen gerne besuchten Kugelsternhaufen finden wir auf der Strecke Arcturus-Cor Caroli fast halbwegs, etwas näher an Arcturus. Oder wir suchen den markanten Winkel 23CVn-20CVn-19CVn-HR4997 zwischen Alkaid und Cor Caroli und hangeln uns dann über Zweiergruppen bis zur Linie HR5145-HD119686-HD120476 mit dem charakteristisch eingefügten Paar HD119944/HD120007. Dort steht M3 unübersehbar bei HR5145. >>>GoToGrafik
Der Kugelsternhaufen Messier 13 ist noch etwas besser zu sehen. Er liegt im Sternbild Herkules und ist zu finden auf der Strecke Eta Her-Zeta Her, 1/3-wegs von Eta Her. Ein anderer Aufsuchweg führt uns über das Sternbild Nördliche Krone/Corona Borealis. Vom Endstern 14CrB gehen wir über die Linie 13CrB-14CrB weiter zur dazu querliegenden charakteristischen Vier-Sterne-Linie HR6046-16CrB-HR5983-HR5957 (mit einem lichtschwacheren Stern/Dreieck in der Mitte). Diese Linie verlängern wir bis zur Strecke EtaHer-ZetaHer und finden den Haufen etwas über dem Schnittpunkt dann beim Paar HD150998/HD150679. >>>GoToGrafik
Oft stehen M3 und M13 zu nahe am Zenit bei günstiger Beobachtungszeit. Dann können z.B. die hellen und ausgedehnten Haufen M10 und M12 (Gumball Cluster) bequem aufgesucht werden. Wir finden sie bei Sabik im Sternbild Schlangenträger. Auch der Kugelsternhaufen M15 in Pegasus, bei Enif und Delta Equulei, ist ein leicht erreichbares Ziel oder der leider meist sehr tief stehende, zusätzlich durch kosmische Staubwolken abgeschwächte M22 im Schützen. >>>GoToGrafik M15
7.2 Vom Seemöwen-Nebel zum Kalifornien-Nebel
Eine Warnung vorweg, ehe wir uns an das Aufsuchen von Nebeln
machen: Nebel benötigen einen dunklen Himmel weitgehend ohne
Mondlicht oder Sonnenrestlicht. Der Einsatz von Filtern
(UHC-, OIII-, H-Alpha- oder H-Beta-Filter) ist meist
empfehlenswert - bringt aber in der Regel nichts, wenn wir
nicht auch ohne Filter schon was sehen. Und auch dann sehen
wir sie vorwiegend in Grautönen. Farbe gibts nur mit
Astrofotografie, mit Langzeitbelichtung und/oder Stacking.
Am besten nochmal lesen, was unter 1.2 zur
"Frustrationstoleranz" steht!Galaktische Nebel (also Nebel in unserer Milchstraße) sind ausgedehnte Gebilde und können oft - bei sehr gutem Seeing - schon mit dem Fernglas identifiziert werden. Bisweilen sind sie für das Teleskop mit seinen hohen Vergrößerungen zu ausgedehnt, um wahrgenommen zu werden, wie das etwa beim Nordamerikanischen Nebel der Fall ist. 10fache Vergrößerung ist bei den großen Objekten ausreichend. Voraussetzungen sind eine hohe Lichtleistung, bei Streulicht hilft zur Kontraststeigerung ein Nebelfilter. Außerdem sollte das Streulicht durch Schutz (beim Fernglas z.B. ein Bino Bandit) abgehalten werden.
Gut sichtbar sind die meisten Nebel im Herbst und im Winter, Winterzeit ist Nebelzeit. Es gibt allerdings auch eine kleine Nebelzeit im Sommer, wenn das an Nebeln reiche Sternbild Schwan und mit ihm auch die Nebelregion Adler-Schild-Schütze höher stehen. Was wir am Nordhimmel sehen können, sind vor allem die Nebel des Milchstraßenbandes von Sirius über Beteigeuze und Alhena bis Capella und nach der kleinen Ausdünnung beim Schild des Perseus weiter von Mirfak über Ruchbah und Deneb bis Altair. Diesem Band folgen wir nun (Ende März). Planetarische Nebel sind weiter gestreut, werden aber in diese Folge mit aufgenommen.
Von Sirius ausgehend stoßen wir im ersten Teil unserer Nebel-Reise mitten im Milchstraßen-Band auf den Möwen-/Seemöwen-Nebel (IC 2177)/Seagull Nebula. Dabei bezeichnet IC 2177 genau genommen nur den Kopf der Möwe. Der interessant geformte Nebel liegt auf der Strecke Sirius-Prokyon, 1/4-wegs von Sirius.
Dann folgt der Orion-Nebel (M42), den wir schon mit bloßem Auge diffus wahrnehmen können. Er befindet sich im Schwert des Sternbildes Orion, im Dreieck Rigel-Salph-Alnitak. Direkt benachbart liegen beim Gürtelstern Alnitak der Flammen-Nebel (NGC 2024) und der Emissionsnebel IC 434 mit dem Pferdekopfnebel, einer Dunkelwolke.
Der Rosetten-Nebel (NGC 2237) ist ein Emissionsnebel im Sternbild Einhorn/Monoceros in 5.200 Lichtjahren Entfernung. Wir können hier unmittelbar die Bedeutung von Emissionsnebeln als Sternentstehungsgebiete wahrnehmen, denn im Nebel befindet sich ein markanter offener Sternenhaufen, NGC 2244. Der Nebel wird in der Katalogisierung in verschiedene Teile unterschieden ( NGC 2237, NGC 2238, NGC 2239, NGC 2246). Zu finden ist er zwischen Beteigeuze und Prokyon, etwa 1/3-wegs von Beteigeuze. >>>GoToGrafik
Mit lichtstarken Teleskopen gibt es in der Nähe, etwas außerhalb des Milchstraßenbandes, den mondsichelförmigen Medusa-Nebel (Abell 21) im Sternbild Zwillinge zu bewundern. Medusa ist ein feingliedriger Planetarischer Nebel, der auf einen Sternentod verweist. Er wurde erst 1955 entdeckt und ist nur mit Mühe aufzufinden an der Kreuzung der Strecken Alhena-Altaf und Prokyon-Wasaf. Hilfreich ist die Orientierung am Sternbild Kleiner Hund/Canis minor.
Im Sternbild Zwillinge liegt auch der (in Fotografien) wunderschöne Eskimo-Nebel (NGC 2392). Dieser helle Planetarische Nebel zeigt sich Teleskopen ab 5''. Allerdings ist er aufgrund seiner geringen Ausdehnung (0,7 Lichtjahre) gleichfalls nur schwer aufzuspüren. Er liegt beim Zwillings-Stern Wasat, Richtung Gamma Gem.
Leichter wird es wieder zurück im Milchstraßenband beim Affenkopf-Nebel (NGC 2174) mit 75 Lichtjahren Ausdehnung und etwa 6.400 Lichtjahren Entfernung von der Erde. Dieser HII-Emissionsnebel hat etwa die scheinbare Ausdehnung des Vollmondes. Einige Sternhaufen liegen in seinem Bereich. Er kann auch im Fernglas schon erkannt werden, vor allem mit geeigneten Filtern, UHC genügt. Wir finden ihn am oberen Rand des Sternbildes Orion.
Gehen wir vom Affenkopf weiter zum Stern Elnath und etwas darüber hinaus finden wir auf der Mittelsenkrechten der Strecke Elnath-Al Kab den charakteristischen Flammender-Stern-Nebel (IC 405), einen Reflexions- und Emissionsnebel, der u.a. vom lichtstarken Stern AE Aurigae, einem "Runaway Star", illuminiert wird. Er liegt im Sternbild Auriga (Fuhrmann), flankiert von Aur16 bis Aur19.
Wenn wir wieder das Milchstraßenband verlassen, nun zur anderen Seite, gleichsam Eskimo und Medusa gegenüber, finden wir die Plejaden-Nebel, unter denen besonders der Merope-Nebel (NGC 1435) beeindruckt. Der Name zeigt schon, wo wir ihn finden, um den Plejaden-Stern Merope.
Und schließlich gelangen wir von den Plejaden aus wieder in Gegenrichtung zum (bei sehr gutem Seeing, genügend großer Öffnung und mit H-Beta-Filter) unübersehbaren Kalifornien-Nebel (NGC 1499), der uns auf die Milchband-Lücke verweist. Er liegt an der linken Perseus-Wade, unweit des Sternes Menkib.
7.3 Vom Seelennebel zum Hantel-Nebel
Nach der Milchstraßen-Lücke beim Perseus-Schild, die eine gute Orientierungs- und Gliederungshilfe bietet, besuchen wir ein zweites reiches Nebelgebiet zwischen Mirfak/Alpha Persei und Altair/Alpha Aquilae, geprägt unter anderem durch das Sternbild Schwan, das im Sommer und im Herbst komfortabel zu sehen ist - im Sommer getrübt durch langes Tageslicht.Von Mirfak über Al Fakhbir und Miram weiter Richtung Segim stoßen wir bald nach Miram etwas oberhalb, zur Seite des Sternbildes Giraffe/Camelopardalis hin, zunächst auf den Seelennebel (SH2-199/IC 1848 u.a.), der beim Hintern der Giraffe liegt. Das ist ein Emissionsnebel in ca. 7.500 Lichtjahren Entfernung, mit einer längsten Ausdehnung von ca. 100 Lichtjahren und mehreren offenen Sternhaufen. Dieses großzügig strukturierte Gebilde bietet besondere Freuden für Astrofotografen.
In der unmittelbaren Nachbarschaft, Richtung Kassiopeia, liegt der ähnlich spektakuläre Herznebel (IC 1805), wie der Seelennebel ein Emissionsnebel aus ionisiertem Wasserstoff-, Sauerstoff- und Schwefelgas mit eingestreuten Dunkelwolken. Beide Nebel erfordern besondere Kenntnisse, entsprechende Ausstattung, Erfahrung.
Richtung Perseus gelangen wir zum Kleinen Hantelnebel (M76), der eine lichtstarke Ausrüstung erfordert. Zur Entfernung dieses Planetarischen Nebels gibt es stark abweichende Angaben zwischen 1.700 und 8.200 Lichtjahren. Wir finden ihn ungefähr halbwegs auf der Strecke Almach (Perseus)-Ruchbah (Kassiopeia), etwas zur Seite von Andromeda abweichend, bei Phi Persei. Im Sternbild Perseus können wir im August den Sternschnuppenregen der Perseiden bewundern.
Mit einem großen Sprung über das Milchstraßenband, weitab zum (inoffiziellen) Sternbild Großer Wagen, finden wir einen weiteren seiner Gestalt wegen geschätzen Planetarischen Nebel, der wie M76 mindestens 8'' und sehr günstiges Seeing erfordert, den Eulen-Nebel (M97). Seine Blautönungen machen ihn auch ohne Filter gut sichtbar - wenn die Umstände stimmen. Aufzuspüren ist er abseits der Strecke Merak-Phecda, an der charakteristischen Dreierlinie HD 97455-HD 97302-HD97125 mit dem Knick zu HD 96832, zwischen HD 97455 und HD 97302. >>>GoToGrafik
Den planetarischen Blauer-Schneeball-Nebel (NGC 7662) können wir im Sternbild Andromeda aufspüren. Er zeigt sich schon in Ferngläser ab 50mm Öffnung als bläuliche Scheibe dank seines Sauerstoffreichtums, ionisiert durch den Zentralstern. Er liegt bei 13 And.
Auf der anderen Seite des Milchstraßenbandes finden wir den Emissionsnebel IC 1396, mit dem Elefantenrüssel (IC 1396A), einer Dunkelwolkenformation. IC 1396 hängt gleichsam am Sternbild Cepheus, am Roten Überriesen Erakis (Granatstern/Garnis Star/Mu Cephei) als "Haken".
Mit einem Schlenker ins Sternbild Drache kommen wir zwischen Altais und Aldhibah zum famosen Katzenaugennebel (NGC 6543) - mit 8'' und 300facher Vergrößerung gibt es bei dunklem Himmel schon eine Ahnung der Form. Ein Katzenauge ist jedoch erst ab 16''/400mm Öffnung zu erkennen.
Weiter zum Sternbild Schwan finden wir an dessen Rand den Nordamerikanebel (NGC 7000), bei Deneb/Alpha Cygni. Wie der Kaliforniennebel wird auch der Nordamerikanebel wegen seiner Ähnlichkeit mit einer geographischen Einheit so genannt. In der Nachbarschaft von NGC 7000 befinden sich weitere interessante Nebelgebilde, vor allem der etwas schwächere Pelikan-Nebel, IC 5070. NGC 7000 zeichnet sich durch seine Ausdehnung und Helligkeit aus.
Vom Milchstraßenband weg Richtung Sternbild Drache liegt der schwierig aufzufindende Blinkende Nebel (NGC 6826) - ein Planetarischer Nebel, etwa 2.200 Lichtjahren entfernt. Das Blinken entsteht als optische Täuschung, wenn das Auge bei Teleskopen mit 8'' Öffnung und einer Vergrößerung von 80- bis 100-fach zwischen Fokussierung und Vorbeiblick wechselt. Wir finden ihn bei 16 Cyg oder mit weiterem Sehfeld bei Theta Cyg.
Zurück im Milchstraßenband, beim anderen Flügel des Sternbildes Schwan, wartet der Nebelkomplex Cirrusnebel/Schleiernebel/Veil Nebula als Teil des Cygnusbogens auf uns. Der Cygnusbogen ist ein ausgedehnter Supernovaüberrest. Sein sichtbarer Teil, der Cirrusnebel, ist in einen Westteil (NGC 6960, "Sturmvogel" oder "Hexenbesen") und einen im allgemeinen einfacher zu erkennenden Ostteil (NGC 6992, NGC 6995, IC 1340) gegliedert. Dazwischen liegen die gleichfalls zugehörigen Nebel NGC 6979 und NGC 6974. NGC 6960 ist teilweise schon mit einem stärkeren Fernglas (mit OIII-Filter) zu ahnen. Er wird markiert durch den hellen Doppelstern 52 Cyg.
Nach dem Besuch im Hexenkessel des Cirrusnebels können wir uns - mit lichtstarker Optik - Erholung gönnen beim Ringnebel (M57), einem Planetarischen Nebel in einer Entfernung von 2.300 Lichtjahren mit einem Durchmesser von 1,3 Lichtjahren. Seine harmonische Gestalt zeigt sich allerdings erst im Sommer und mit Objektiven ab 8'' ansatzweise bei höherer Vergrößerung. Der Ringnebel ist ein Planetarischer Nebel und liegt im unteren Bereich des Sternbildes Leier/Lyra, ziemlich genau halbwegs zwischen Sulafat und Sheliak. Seiner geringen scheinbaren Helligkeit und Ausdehnung wegen ist er allerdings nicht auf Anhieb zu finden. >>>GoToGrafik
Unsere Reise durch das Nebelband zwischen Mirfak und Altair endet beim gut zu sehenden Hantelnebel (M27), einem Planetarischen Nebel von 3 Lichtjahren Durchmesser in 1.400 Lichtjahren Entfernung, der an eine Sanduhr oder eben eine Hantel erinnert. Sein energiereicher Zentralstern sorgt für angeregtes Leuchten der Gashülle. Schon im Fernglas ist er als deutlicher Lichtfleck erkennbar, in Teleskopen zeigt er ab 5'' die Hantelform. Ein UHC-Filter macht die Struktur deutlicher. Er steht im Sternbild Fuchs/Vulpecula bei 14 Vul, dem mittleren Basisstern des "M", das von 17, 16, 14 und 12 Vul gebildet wird. Ein anderer Weg führt vom Sternbild Pfeil aus, von 16 Sge über eine Folge von Sternpaaren zu einer schräg liegenden Dreier-Sternlinie (HD189657-HD189733-HD345459), über der wir den Hantelnebel deutlich erkennen. >>>GoToGrafik
Südlich des Hantelnebels finden wir im Sommer die drei lohnenden Objekte M8 (Lagunen-Nebel), M16 (Adler-Nebel) und M17 (Omega-Nebel), lichtstarke und gut umrissene Nebelformationen zwischen Schild/Scutum und Schütze/Sagittarius, auch im Fernglas mit OIII-Filtern ordentlich zu sehen, allerdings meist nahe am Horizont. Nahe beim Lagunennebel finden wir gleichfalls bequem mit dem Fernglas den im Teleskop leicht aufzulösenden Kugelsternhaufen M22. Schön im Spätsommer/Herbst auch der Helix-Nebel (NGC 7293) bei günstigen Bedingungen mit einem lichtstarken Fernglas, ein Planetarischer Nebel mit der VM +7.59, "Auge Gottes" genannt, beim Sternbild Aquarius, nahe Fomalhaut. Eine besonders delikate Spätsommer-Frühherbstfahrung mit einem größeren Teleskop ist in der Nähe der grün-bläuliche planetarische Saturn-Nebel (NGC 7009), der oft bei seinem Namensgeber weilt, dessen Form er andeutet. >>>GoToGrafik M8 M16 M17 M22
7.4 Galaxien zum Einstieg
Galaxien benötigen in der Regel eine aufwendigere Suche als
Sternhaufen und Nebel. Mit bloßem Auge können wir nur die
Andromeda-Galaxie als diffusen hellen Fleck
wahrnehmen. Bei sehr gutem Seeing erhaschen wir unweit
von ihr bisweilen auch noch einen Blick auf die
Dreiecksgalaxie. Am Südhimmel zeigen sich die beiden
Magellanschen Wolken dem Betrachter ohne Gerät. Dem Fernglas
sind am Nordhimmel noch die größere und hellere Bode-Galaxie
M81, die Whirlpool- und die Feuerrad/Pinwheel-Galaxie
zugänglich. Einige weitere Galaxien können wir schon mit
kleineren Teleskopen ohne GoTo aufspüren. Erfahrene
Beobachter kommen mit einem Fernglas 10x50 zu allen hier
aufgeführten Galaxien - in der Regel allerdings nur als
Lichtpunkte/Lichtnebel.Geordnet habe ich die Galaxien grob nach ihrer Entfernung zu uns, was weitgehend mit ihrer Sichtbarkeit korrespondiert - auch wenn dafür neben der Entfernung auch Ausdehnung und Helligkeit eine Rolle spielen. Galaxienzeiten sind Frühling und Herbst.
Die Andromeda-Galaxie (M31) liegt in ca. 2,5 Millionen Lichtjahren Entfernung im Sternbild Andromeda und ist bequem mit dem Fernglas aufzusuchen über den Stern Mirach. Von diesem aus gehen wir weiter zu My And und Ny And. Etwas über Ny And hinaus finden wir bei einigermaßen gutem Seeing diese Spiralgalaxie. Ihre größte Begleitgalaxie, M110, eine elliptische Galaxie mit gleichmäßiger Lichtverteilung, ist dem Fernglas bei besserem Seeing gleichfalls als Lichtpunkt zugänglich. >>>GoToGrafik
Richtung Süden stoßen wir beim Sternbild Dreieck/Triagulum auf die im Fernglas als "Wattebausch" zu sehende, nach dem nahen Sternbild benannte Dreiecksgalaxie (M33), englisch auch Pinwheel Galaxy genannt (die "eigentliche" Pinwheel Galaxy ist jedoch M101). Ihre Entfernung beträgt etwa 2,7 Millionen Lichtjahre. Wir finden sie auf der Strecke Mirach-Hamal, 1/3-wegs von Mirach. Sie sitzt schräg neben oder unterhalb der beiden auffallenden Sternpaare HD9070-HD9012 und HD8909-HD8826 in einem "Kasten" aus vier weniger hellen, dennoch markanten Sternen. >>>GoToGrafik
Wesentlich weiter entfernt von uns liegen mit ca. 12 Millionen Lichtjahren die beiden "Bode-Nebel" (M81, M82) beim Großen Bären. Die Senkrechte auf der Strecke Dubhe-Muscida zu Polaris führt uns nach etwa einem Drittel der Streckenlänge Dubhe-Muscida zu ihnen. M81 sehen wir als hellen Lichtpunkt, M82 etwas schwächer, dafür mit auffallender länglicher Gestalt ("Zigarrengalaxie"). >>>GoToGrafik
Gut mit dem Fernglas erreichbar ist bei dunklem Himmel auch die ausgedehnte Feuerrad-Galaxie (M101), Pinwheel Galaxy, mit 170.000 Lichtjahren Ausdehnung, in 16/21/25 (verschiedene Angaben) Millionen Lichtjahren Entfernung. Sie zeigt (allerdings erst ab 150mm) das allgemeine Wunschbild einer Galaxie. Wir finden sie bei der Deichsel des Großen Wagens auf der Mittelsenkrechten der Achse Mizar-Alkaid zur Drachen-Seite hin nach etwa zwei Dritteln der Streckenlänge Mizar-Alkaid. >>>GoToGrafik
Wesentlich schlechter zu sehen, obgleich "nur" 17 Millionen Lichtjahre entfernt, ist das Blaue Auge (M64), Black Eye, eine optisch interessante Spiralgalaxie mit Dunkelwolke, im Sternbild Coma Berenices. Wir finden sie auf der 2/3-Senkrechten der Strecke Beta Comae Berenices-Alpha Comae Berenices/Diadem im Zentrum eines etwas verschobenen Trapezes von vier Sternen, dessen hellster 35 Comae Berenices ist.
Zwischen den Schnauzen der Jagdhunde und dem Hintern des Großen Bären liegt die Balken-Spiralgalaxie M106, eine Seyfert-Galaxie mit immenser Röntgenstrahlung, rund 24 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Wir müssen sie auf der Achse Phecda-Chara suchen, etwas weniger als halbwegs von Chara her.
Unbedingt lohnend und relativ einfach zu haben ist ein Besuch der Strudelgalaxie (M51), Whirlpool Galaxy. Sie liegt am Deichselgriff des Großen Wagens. Ihre Entfernung von uns wird auf 25 Millionen Lichtjahre geschätzt. Ihre Gestalt ist markant wie die von M101 - allerdings kompakter und klarer. Wegen der gravitativ und optisch (durch einen Schweif) verbundenen kleineren Galaxie NGC 5195 ist sie gut aufzuspüren bei Alkaid, etwa rechtwinklig abzweigend von der Strecke Mizar-Alkaid. >>>GoToGrafik
7.5 Galaxien zum Grübeln
Schwieriger wird es bei der folgenden Gruppe von Galaxien -
wegen schlechter Sichtbarkeit und/oder weil es weniger
Aufspürhilfen gibt. Wobei ich mich auf Galaxien beschränkte,
die mit Optiken bis 8'' zu erreichen sind - auch wenn dies
nicht immer einfach ist. Einige - erkennbar an der
Messier-Nummer - können unter günstigen Bedingungen durchaus
auch im großen Fernglas gesehen werden, als Lichtpunkt oder
wattige Helligkeit.Zur Sonnenblumen-Galaxie (M63/NGC 5055) sind es etwa 29 Millionen Lichtjahre. Zu sehen ist sie im Sternbild Jagdhunde/Canes Vernatici, wenn wir von M51 weiter gehen Richtung Cor Caroli/Alpha2 Canum Vernaticorum. Als Peilhilfe können von M51 her die beiden nebeneinander stehenden Sterne HIP65135 und HIO65230 dienen. Auch die Linie der Sterne 19, 20, 23 Canum Vernaticorum, ergänzt zum Dreieck durch HIP64540, kann Hilfestellung geben.
In 25 bis 29 Millionen Lichtjahren Entfernung liegt die gut erkennbare Walgalaxie (NGC 4631), eine Balken-Spiralgalaxie mit einer Ausdehnung von etwa 100.000 Lichtjahren. Sie hat eine kleinere Nachbargalaxie, NGC 4627 - die "Fontäne". Wir kommen zu ihr auf dem Weg von Cor Caroli zum Coma Berenices Cluster (Mel 111). Sie liegt dann auf der Linie 37 Comae Berenices-HIP61309, wo die Senkrechte zu Cor Caroli aufsteigt. Von hier aus können wir auch einen Sprung machen zur Hockeschläger-Galaxie (NGC 4656/57). Diese charakteristisch verformte Galaxie stand in der Vergangenheit wohl in Wechselbeziehung mit der Walgalaxie.
Die eindrucksvolle Sombrero-Galaxie (M104), eine leuchtstarke Spiralgalaxie (VM +8.12) in etwa 30 Millionen Lichtjahren Entfernung, finden wir zwischen den Sternbildern Jungfrau und Rabe, annähernd halbwegs zwischen den Sternen Kraz (Rabe/Corvus) und Porrima (Jungfrau), in der Nähe strahlt bläulich Spica, ein anderer (variabel) leuchtstarker (Doppel-)Stern in der Nähe ist Algorab. Hilfreich kann der Ausgang von den drei eine Linie bildenden Sternen HD 109875, HD 109899 und HD 109916 sein oder die Orientierung an der Linie durch VV Corvi und Chi Virginis. >>>GoToGrafik
Im Sternbild Löwe liegt das famose Leo-Triplett (M65, M66, NGC 3628), drei Spiralgalaxien, wovon die ersten beiden ca. 32 Millionen, die seitlich zu sehende Hamburger-Galaxie NGC 3628 etwa 34 Millionen Lichtjahre entfernt von uns liegen. Aufgefunden wird das Triplett (auch M66-Gruppe genannt) bei Ny Leonis und HD 98354. Annähern können wir uns über das Dreieck HD98388-HD98354-73Leo. Ein weiteres, weniger lichtstarkes Triplett liegt beim rötlichen k Leonis/52 Leo. Es besteht aus M95, M96 und M105. Eigentlich ist es ein Quartett, zusammen mit NGC 3384. M96 ist mit einer VM von 9.17 am hellsten für uns, weshalb auch von der M96-Gruppe gesprochen wird. Die andere Namensgeberin M66 hat eine VM von 8.91.
Unmittelbar beim Bärenstern Phecda/Gamma Ursae Majoris stoßen wir auf die Galaxie M 109 (VM 9.62), wenn wir uns zur Linie Megrez-Al Kaphrah, zu den Jagdhunden hin bewegen. Sie ist Bezeichnungsgeberin für eine ganze Gruppe schwer aufzufindender Galaxien (Ursa-Major-Wolke), liegt etwa 34 Millionen Lichtjahre von uns entfernt und ist 100.000 Lichtjahre ausgedehnt.
Beim Großen Bären können wir auch die Surfbrett-Galaxie (M108) mit ihrem rätselhaften Galaxienkern besuchen, eine Balken-Spiralgalaxie in etwa 45 Millionen (nach anderen Angaben 32 Mio) Lichtjahren Entfernung, die wir in Schräglage, fast seitlich sehen. Sie liegt an der Strecke Merak-Phecda, näher an Merak, etwas zur Seite des Löwen hin, beim Eulennebel.
Mit der Nadel-Galaxie (NGC4565) beim Coma-Berenices-Sternhaufen (Mel 111) rücken wir weitere 10 Millionen Lichtjahre von uns weg, bleiben aber noch im Grenzbereich der mit 8'' (nun mehr schlecht als recht) zugänglichen Galaxien. Ihre namensgebende längliche Form erleichtert die Identifikation, dennoch können wir hier ohne technische Aufsuchhilfe bei der Suche im Heuhaufen heftig irre gehen.
Im Zentrum des Virgo-Supergalaxienhaufens liegt in großräumiger Nachbarschaft der Nadel die Riesengalaxie Virgo A (M87/NGC 4486), eine elliptische Galaxie, umhüllt von etwa 12.000 (nach anderen Angaben 16.000) Kugelsternhaufen (unsere Milchstraße hat davon vermutlich 500), gleichfalls in einer Entfernung von etwa 55 Millionen Lichtjahren. Sie ist umringt von unzähligen Galaxien, von denen wir mit einem 8-Zöller einige beobachten können, so M58, M86 (Markarian's Chain), M88, M90, M91 oder etwas weiter weg von Virgo A die Galaxien M98, M99 (Coma Pinwheel), M100. Wobei vor allem M100 die "klassische" Spiralform präsentiert.
7.6 Himmelswanderungen mit dem Fernglas
Die nachfolgenden Vorschläge sind für das Fernglas
gedacht. Es ist hilfreich, schon Aufsucherfahrungen mit
den einfacheren GoTo-Übungen von oben gesammelt haben.
Brillenträger mit größeren Problemen bei der Fernsicht
ohne sollten die Brille aufbehalten, da der ständige
Wechsel von Auge auf Glas und zurück lästig werden kann.
Auch wenn von vielen Objekten nur kleine Nebelflecken,
"Wattebäusche", sichtbar werden im Fernglas, bringen
solche Streifzüge unschätzbare Erfahrungen. Wie bei einer
Tour in der Bergen sollten wir uns Rasten gönnen, längere
ruhige Betrachtungen. Und wir sollten nicht nur unsere
Ziele im Auge haben, sondern uns auch rechts und links vom
Wege umschauen.
Und denken Sie an einen bequemen Sitz mit Nackenstütze
und möglichst auch Ellbogenstütze! Das ist der wichtigste
Ausrüstungsgegenstand, neben dem Glas. Auf dem heimischen
Balkon dient uns ein Campingstuhl mit hoher, verstellbarer
Rückenlehne und möglichst auch Armstützen. Unterwegs
sollte zumindest eine Schaumstoffmatte, ein Bodenstuhl
oder ein Klapphocker mit dabei sein. Warme Kleidung nicht
vergessen in den entsprechenden Jahreszeiten - denn im
Unterschied zu "normalen" Wanderungen werden wir uns vor
allem mit dem und im Kopf bewegen, weniger mit den Beinen.
Größere Gläser erfordern ein Stativ oder eine Aufhängung -
etwa die von mir entwickelte flexible Aufhängung mit
Umlenkrollen und Gegengewicht.
Beim Möwennebel: Südlich des Möwennebels, beim
Sternbild Großer Hund, befindet sich eines der reichsten
Sternhaufen-Gebiete. Besuchen können wir es allerdings nur
Januar bis März, vorzugsweise Februar, wenn der Große Hund
sich weit genug vom Horizont ablöst - und wir nicht gegen
Süden einen Berg vor uns haben. Mit dem Fernglas sind von
diesem Reichtum, der sich unterhalb des Horizontes in der
Südhemisphäre fortsetzt, vor allem die Offenen Haufen M93,
Collinder 121, M41, M46 und M47 zugänglich. Es lohnt sich
allerdings, auch nach anderen Ausschau zu halten.
Zahlreiche Haufen finden sich im und nahe beim Möwennebel,
einem Emissionsnebel. Einige Planetarische Nebel sind hier
auch zuhause, allerdings für das Fernglas zu lichtschwach.
Am ehesten wird man bei NGC 2440 (östlich) und IC 2165
(westlich) einen flüchtigen Lichtblick erhaschen. >>>GoToGrafik
Im Revier des Löwen: Ab Ende Februar kommt der
Löwe so weit über den Horizont, dass wir ihn bequem
besuchen können, um etwas Erfahrung im Auffinden von
Galaxien zu sammeln bei klarem, dunklem Himmel. Zwei
Gruppen von schon dem großen Fernglas zugänglichen
Galaxien gibt es am Bauch des Löwen, einmal das bekannte
Leo-Triplett (M66-Triplett) aus M65, M66 und NGC3628,
unterhalb von Certan, beim gelben Stern n Leonis, einmal
die schwierigere Gruppe aus M95, M96, M105, ergänzt um die
schwächere NGC3384 und weit schwächer (eher nichts fürs
Glas) NGC3389 bei M105, 1/3-wegs von Certan Richtung
Regulus, nach Süden versetzt beim gelben Stern k Leonis.
Besonders gut ist davon mit dem großen Glas M66 zu sehen.
Flankiert wird der Löwe von zwei Offenen Sternhaufen, die
wir schon mit bloßem Auge erkennen können, dem
Bienenkorb-Haufen im Sternbild Krebs, am Maul des Löwen,
und dem Coma-Berenices-Haufen Mel 111 im gleichnamigen
Sternbild am Löwen-Schwanz. Mit dem Fernglas entdecken wir
noch ohne große Mühe den Haufen M67, beim Krebs-Stern
Acubens, unterhalb des Bienenkorbes. Einer der vielen
bemerkenswerten Sterne des Löwen ist Rho Leonis, der
unweit der größeren Galaxiengruppe bläulich strahlt. In
seinem Bereich gibt es einen kleineren Meteoriten-Schauer,
die Rho Leoniden, Schwerpunkt 1. bis 4. März. Ein sehr
schöner Doppelstern in Leo ist der gelbe Algieba, die
Trennung (des etwas kleineren weißen Partners) beginnt
allerdings erst bei 200facher Vergrößerung. >>>GoToGrafik
Galaxien-Trekking: Im Frühling stehen zahllose
Galaxien hoch am Himmel, in einem riesigen Areal, das
markiert ist durch die Sternbilder Großer Bär, Löwe, Coma
Berenices und Jagdhunde, prominent flankiert durch das
Sternbild Jungfrau. Viele Messier-Galaxien befinden sich
hier, die unter günstigen Umständen auch dem Fernglas
zugänglich sind. Zumindest für einen diffusen Licht-Blick
oder ein kurzes Flackern. Das Zentrum liegt zwischen den
Sternen Denebola (Löwe) und Vindemiatrix (Jungfrau). Rund
um die Riesengalaxie M87 (Virgo A) versammeln sich die
Messier-Objekte M49 (gleichfalls eine Riesengalaxie), M58,
M59, M60, M61, M84 (Markarian's Chain Anfang), M86, M88,
M89, M90, M99 (Coma Pinwheel) und M100 - Mitglieder des
mehr als 3.000 Galaxien umfassenden Virgo-Haufens. Für
dieses Trekking sollten wir uns eine besonders klare,
lange Nacht in einem lichtarmen, abgelegenen Gebiet
vornehmen. Auf zum "Lost in Space"-Gefühl! >>>GoToGrafik
Lagunen-Wanderung: Der Sommer ist für das Fernglas Nebelzeit - vor allem falls man bereit ist, lange aufzubleiben oder mitten in der Nacht aufzustehen. Gemeint sind die nicht-planetarischen Nebel, die grundsätzlich wenig geeignete Kandidaten für das Fernglas sind, mit raren Ausnahmen wie dem Orion-Nebel, dessen Zeit im Winterhalbjahr liegt. Aber von Juli bis September stehen einige andere lichtstarke nicht-planetarische Nebel genügend weit über dem Horizont, um sie schon relativ früh in der Nacht mit dem Fernglas betrachten zu können. Allen voran der am tiefsten stehende Lagunen-Nebel M8, auch Stundenglasnebel genannt, dessen Anblick schon den Anfänger etwas von den Geheimnissen des Weltraums ahnen lässt. Er steht zwischen Schütze und Skorpion, die hellen Sterne Nunki, Kaus Borealis und - etwas entfernter - der rötliche Antares bieten Orientierung. Gleich oberhalb des Lagunen-Nebels steht der kleinere Trifid-Nebel M20, weiter nördlich sehen wir den Omega-Nebel M17 und den Adler-Nebel M16. Zwischen Trifid-Nebel und Omega-Nebel entfaltet sich der farbenfreudige Schütze-Sternhaufen M24. Nebenbei können wir auf der Tour auch zahlreiche Kugelhaufen besuchen. Vor allem der helle Haufen M22 ist einfach zu sehen, direkt neben dem rötlichen 24 Sagitarii - unweit strahlen der blaue Nunki und der gelbe Kaus Borealis. Bei guter Horizontsicht entdecken wir unterhalb des Lagunen-Nebels auch das südlichste Messier-Objekt, den Ptolemäus-Sternhaufen M7, bei Kaus Australis. Es lohnt sich, dafür auch mal auf einen Hügel zu steigen. Etwas höher, dafür lichtschwächer und kleiner liegt in der Nachbarschaft der nette Schmetterlings-Haufen M6. >>>GoToGrafik
Wanderung im Altair-Gebiet: Ein ausgesprochen vielseitiges und doch einfaches "Wandergebiet" ist der Bereich um den Adler-Stern Altair, geeignet für Spätsommer/Herbst (im Sommer oft leidend unter dem Sonnenrestlicht). Wir finden hier drei nette kleine Sternbilder, Fohlen, Delfin und Pfeil. Dazu kommt die attraktive Konstellation Kleiderbügel in einem vermutlich unechten Offenen Sternhaufen (Collinder 399), und der im Glas nur diffus zu sehende Wildenten-Haufen (M11) beim Stern Lambda Aquilae. An lohnenden Kugelhaufen entdecken wir bei Enif, der Nase von Pegasus, den Haufen M15 und bei Sadalsuud im Sternbild Wassermann M2. Vom Sternbild Pfeil kommen wir bequem zum Kugelhaufen M71 und zudem zum berühmten Hantelnebel M27. Diese Wanderung wartet unter einem Alpenhimmel noch mit einer besonderen Seherfahrung auf: Unweit von Tarazed/Gamma Aquilae, bei HD 185898, liegt das Adler-E, registriert mit den Nummern Barnard 142 und 143. Das sind zwei Dunkelnebel, die alle dahinter liegenden Sterne verdecken und dabei die Gestalt eines "E" formen - bei sehr günstigen Bedingungen und mit etwas Phantasie. Bei den Schwanzfedern des Adlers finden wir den Wildenten-Haufen. >>>GoToGrafik
Kreuz und quer im Gemüsegarten: Im frühen Herbst lässt sich südöstlich von Altair ein wunderbarer kleiner Ausflug für Geübte machen, der etwas vom Sammeln eines Erntedank-Straußes hat. Unterhalb der linken Hand des Wassermanns finden wir drei schöne DSO beim Stern Albali wie am Schnürchen aufgereiht: den Nebel NGC 7009, den Offenen Haufen M73 und den Kugelsternhaufen M72. Alle drei lassen sich mit einem großen Glas (ich verwende ein APM 20x110) beobachten. Am Besten startet man mit einfacheren Objekten oberhalb des Wassermanns, etwa dem Kugelhaufen M15, dem Kugelhaufen M2 beim Kopf des Wassermanns oder auf der anderen Seite dem geheimnisvollen Wildentenhaufen M11. Wenn das Revier abgesteckt ist, tasten wir uns vor zu Nu Aquarii, in dessen westlicher Flucht sich die drei DSO reihen. Die Sternenkette Nu Aquarii bis HR 7976 bietet eine vorzügliche Orientierung, um die Objekte sicher auszumachen. Am eindrücklichsten zeigt sich NGC 7009, der Saturnnebel, mit einem länglichen, bläulichen Flirren, in einem flachen Dreieck mit Nu Aquarii und HD 200750. Der Offene Haufen M73 ist mit etwas Geduld an seinen Ausfransungen von einem Stern zu unterscheiden, oberhalb des Dreiecks HD 200004, HD 199828, QS Aquarii. Bei indirektem Sehen leuchtet der Kugelhaufen M72 heller auf als der benachbarte, Orientierung gebende Stern HR 7976. Eine Galaxie hat unsere Kette auch noch in der westlichen Verlängerung, die Aquarius Dwarf Galaxy PGC 65367. Mit einer VM von 14,6 liegt sie leider weit außerhalb der Reichweite von Ferngläsern - wir können aber das rote Sternpaar HD 197801 und HD 197834 ausmachen, das seine Position bestimmt. Bei sehr günstigen Bedingungen finden wir mit dem Glas weiter unten im Süden im linken Knie des Wassermanns noch den spektakulären Helixnebel, NGC 7293, auch "Gottes Auge" genannt.
Beim Himmels-W: Das Sternbild Kassiopeia, das Himmels-W, gehört zu den zirkumpolaren Sternbildern, wie Kepheus (in der griechischen Mythologie Gattin der Kassiopeia), wie Großer und Kleiner Bär, Drache und Giraffe. Obgleich wir sie also das ganze Jahr über mehr oder weniger klar am Himmel sehen können, empfiehlt sich vor allem der Herbst als Beobachtungszeit. Dann steht sie zwar genickbedrohlich nahe am Zenit (ggf. Liegeposition wählen!) zu zivilen Beobachtungszeiten, aber in ihrem Süden befinden sich zahlreiche lohnende Ziele, die Horizonthelligkeit nicht mögen. Wir können dann bei ihr selbst mit dem Fernglas zwei Galaxien (Andromeda und Triangulum), zahlreiche Offene Sternhaufen (darunter der Doppelhaufen Ha-Chi-Persei, der Alpha-Persei-Haufen, der Eulenhaufen/ET und M34), den eigentümlichen Asterismus "Kembles Kaskade" und schließlich zwei interessante galaktische Nebel (Herznebel und Seelennebel) aufspüren - auch wenn Letztere ohne Filter nur bei sehr guten Bedingungen, mit Filter auch nicht immer zu sehen sind und eine große Öffnung erfordern. Und mit viel Glück bekommt man auch den Kleinen Hantelnebel, M76, zu sehen oder gar (geeignete ß-Filter und optimale Bedingungen vorausgesetzt) den Kaliforniennebel. Als Besonderheit kann in der Nähe noch der rot funkelnde Granatstern besucht werden. Kassiopeia ist eines meiner Lieblingssternbilder und auch mit Filter gut aufzuspüren im Fernglas über Segin mit dem charakteristischen Sternepfeil in seiner Nähe, mit HR 567 als Spitze.
Große Haufen-Tour: In schwindelnde Höhen führt uns die im Herbst gut anzugehende Haufen-Tour, von der Horizontnähe mit den Hyaden (150 LJ) über die Plejaden (395 LJ) und den Alpha-Persei-Haufen (560 LJ) zum "Gipfel" des Doppelsternhaufens Ha-Chi-Persei (6.800/7.600 Lichtjahre/LJ entfernt), oben bei Kassiopeia, dem Himmels-W. Die Hyaden/Regensterne gruppieren sich bei ihrem "Hirten" Aldebaran. Die Plejaden/M45, sieben Nymphen der griechischen Mythologie, waren für die Menschheit schon in den Zeiten der Höhlen von Lascaux (wo sie verewigt sind) ein Wegbegleiter. Der Alpha-Persei-Haufen (Mel 20) um den gelben Überriesen Mirfak/Alpha Persei enthält einige auffallend blaue Sternen, die etwa gleichzeitig entstanden sind. Ha-Chi-Persei zeigt starke Farbkontraste in Weißblau und Orange/Kupferfarben. Unsere Tour wird flankiert - gleichfalls von unten nach oben gesehen - von den Offenen Sternhaufen M36 (Pinwheel Cluster), M38 (Starfish Cluster), M34 und Stock 2. Wobei wir die wenig ausgedehnten M36 und M38 nur als strukturierte Wattebäusche mit einigen isolierbaren Sternen sehen in einem guten Glas. Stock 2 ist ein wenig besuchter Haufen etwas nordöstlich von Ha-Chi, sehr schön in seiner Ausgedehntheit mit dem Fernglas zu studieren und hilfreich beim Aufspüren des Herznebels. >>>GoToGrafik
Bei den Zwillingen: Zwillinge und Fuhrmann/Auriga markieren ein leicht überschaubares Gebiet für entspannte Streifzüge im Spätherbst/Frühwinter. Es gibt hier zahlreiche nicht-planetarische Nebel, von denen der Flaming Star Nebula/Flammensternnebel/Flammender-Stern-Nebel im Norden, der Krebsnebel M1 im Westen und der Konusnebel/Weihnachtsbaumnebel im Süden bei günstigen Umständen schon dem großen Fernglas zugänglich sind. Gleichfalls zahlreich sind die Offenen Sternhaufen, von denen M35, M36 (Pinwheel Cluster), M37 und M38 (Starfish Cluster) besonders ins Auge fallen. NGC 2392, der Eskimonebel, ein Planetarischer Nebel, liegt südlich des Sternbildes Zwillinge, bei Wasat. Genießen Sie es, hier einfach das Glas schweifen zu lassen und die Farben der Sterne zu studieren. Besonders westlich von M36 und M38 gibt es viel Farbigkeit zu entdecken, im Umkreis von AE Aurigae, dem Runaway Star, der den Flammensternnebel zum Leuchten bringt. >>>GoToGrafik
Orion-Wanderung: Eines der schönsten Sternbilder für das bloße Auge ist der mit Schwert gegürtete Orion im Winterhalbjahr. Zusammen mit Fuhrmann/Auriga (liegt im Milchstraßenband) birgt er zahlreiche lohnende Fernglas-Objekte. Auffallend ist Orion zunächst durch seine beiden hellen Sterne Beteigeuze im Norden und Rigel im Süden. Dazwischen liegen die drei blauen Gürtelsterne Alnitak, Alnilam und Mintaka. Blau ist die dominierende Farbe in diesem Sternbild. Allerdings besitzt Orion mit Beteigeuze auch einen der berühmtesten roten Überriesen. Beteigeuze und Rigel bilden zusammen mit Sirius das Winterdreieck. Orion zeigt uns in seinem Schwert den einzigen nicht-planetarischen Nebel, den wir im Winterhalbjahr ohne Hilfsmittel wahrnehmen können. Weniger gut sichtbar sind der kopfstehende Weihnachtsbaum-Sternhaufen im gleichnamigen Nebel NGC 2264 (auch als Konusnebel/Cone Nebula bekannt) und der Rosetten-Nebel, für die wir ein starkes Fernglas und besonders günstige Bedingungen benötigen. Wobei wir die zugehörigen Sterne einfacher finden. Der Schürhaken des Sternbildes Kleiner Hund/Canis Minor mit Procyon und die Hyaden um den Stern Aldebaran im Sternbild Stier sind weitere ansprechende Ziele in der Nachbarschaft. Im Norden lohnend sind der Offene Sternhaufen M35 und der Krebsnebel M1 (schwach, diffus), Überrest einer Supernova im Jahr 1054. Die Sternhaufen M41, M47 (in Puppis) und M50 sind von Sirius aus mit dem Glas gut aufzufinden - stehen jedoch nur ab Anfang Januar bis März hoch genug über dem Horizont zu alltagsverträglichen Beobachtungszeiten. >>>GoToGrafik
Kassiopeias Haufenwelt: Im Winter liegt Kassiopeia auf der dem Orion abgewendeten Himmelsseite, was sie zu einer guten Alternative oder Ergänzung - je nach Bewölkung, Mondposition und sonstigen möglichen Einschränkungen - zur Orion-Wanderung macht. Durch seine Lage im Milchstraßenband bietet das Sternbild eine Fülle interessanter Deep Sky Objekte. Für das Fernglas erreichbar sind die Offenen Sternhaufen, angefangen im Norden oberhalb von Segin (unverwechselbar durch den Sternepfeil mit der Spitze HR 567) mit dem ausgedehnten Haufen Stock 2, dann weiter zu NGC 663 und dem benachbarten, weitaus schwächeren NGC 654 sowie dem wieder leuchtstärkeren M103 auf dem Weg von Segin zu Ruchbah. Einen lohnenden Zwischenhalt bietet NGC 457, der Eulenhaufen, bekannt auch als ET, zwischen Ruchbah und Navi. Der sehr schwache NGC 225 und der prägnantere NGC 129 folgen dann zwischen Navi und Caph. M52 gibt den krönenden Abschluss im Süden von Caph. Von Messier übersehen wurde NGC 7789, die "Weiße Rose" oder "Carolines Rose", von Caroline Herschel entdeckt, weniger gebündelt als M52, aber sehr licht und reizvoll, gleichfalls bei Caph. Etwas weiter ausschweifend kann man noch Ha-Chi-Persei (NGC 869 und 884), den famosen Doppelsternhaufen bei Segin und Ruchbah, besuchen.
8 Vermischtes
Einige mir wichtige Themen und Betrachtungen von allgemeinem
Interesse waren in der vorangegangenen Systematik nicht
unterzubringen. Ich füge sie hier an.8.1 Tagbeobachtung
Bei Tagbeobachtungen, die nicht der Sonne gelten, unbedingt die Sonnennähe meiden, am Besten sich im Schatten aufstellen. Denn schon ein versehentlicher Blick mit dem Fernglas in die Sonne kann die Augen unwiderruflich schädigen! Eine Schattenposition erhöht nebenbei auch die Sensitivität der Augen.
Zur Tagbeobachtung eignet sich neben der Sonne
naheliegenderweise zunächst der Mond, der auch bei Tage
oft genügend Licht von der Sonne abbekommt, um bei klarem
Himmel ein lohnendes Beobachtungsobjekt abzugeben.
Aber auch die beiden inneren Planeten Venus und Merkur
bieten sich an. Sie stehen tagsüber höher am Himmel als
nachts. Details ihrer Oberflächen sind bei Tag besser zu
erkennen als bei Nacht. Jupiter und Saturn können am Tag
durchaus auch lohnend sein, besonders für Astrofotografen.
Bei Sternbeobachtung am Tag ist GoTo besonders sinnvoll,
da die eigene Orientierung vor dem hellen Hintergrund
schwierig ist. Eine hohe Vergrößerung zur Reduzierung der
Hintergrundhelligkeit wird von einigen Tagbeobachtern
empfohlen. Auch die Verwendung von Rot- oder
Orangefiltern, um das Himmelsblau zu reduzieren, und von
Polarisationsfiltern schafft bessere Kontraste. Im
Hochgebirge ist der Himmelsgrund dunkler als im Flachland,
was dem Seeing bei Tage förderlich ist.
Ein weiteres beliebtes Objekt für Tagbeobachtungen sind
Kometen. Einige der beeindruckendsten Kometenbeobachtungen
konnten bei Tag gemacht werden, so zeigte sich etwa am 13.
Januar 2007 McNaught am hellen Tage unter dem Nordhimmel.
Zu bedenken ist bei Tagbeobachtungen, dass Teleskoptuben
häufig dunkel gefärbt sind, was zu massiver Erhitzung bei
Sonnenbestrahlung führen kann! Auch dies ist ein wichtiges
Argument für die Aufstellung im Schatten. Bei Tag sind im
Gelände zudem unter Umständen zahlreiche Insekten
unterwegs - vor dem Einpacken ggf. Abschütteln nicht
vergessen!
8.2 Aufzeichnungen
Viele Astronomie-Enthusiasten empfehlen Anfängern das Führen
eine Beobachtungstagebuchs. Das soll dreierlei leisten: Die
Wahrnehmung schärfen, Vergleiche ermöglichen und der
Erinnerung aufhelfen.Die Wahrnehmung wird vor allem durch das Anfertigen von Skizzen, Beobachtungskarten geschult. Das kennen wir aus der großen Zeit des bürgerlichen Reisens, etwa von Goethe, der seine "italienische Reise" nicht nur schriftlich, sondern auch in zahlreichen Zeichnungen von Landschaften, Pflanzen, Architektur und Menschen festhielt. In der Amateur-Astronomie ist ein bekannter Skizzen-Meister Ronald Stoyan, Autor des "Deep Sky Reiseführers". Was wir selbst abzeichnen, müssen wir genau studieren, wir müssen Sterne zählen, Entfernungen taxieren, Winkel einschätzen, Positionen der Objekte zueinander bestimmen, Umrisse erfassen.
Eigenes Zeichnen erleichtert auch das Wiederfinden von Objekten, zu denen wir einen guten Weg gefunden haben, den die Skizze dokumentiert. Allerdings sollten wir immer mit bedenken, dass die Welt am Himmel in steter Bewegung und Verschiebung ist. Das schlichte Rechts-Links, Oben-Unten unserer "flachen" Welt gilt bei den Sternen nur mit Einschränkung. Ihre Positionen zueinander bleiben zwar (relativ) gleich, darauf verweist die alte Bezeichnung "Fixsterne", aber nicht ihre Positionen zu uns. Und das hat für den optischen Eindruck erhebliche Konsequenzen. Wer ohne Amici-Prisma häufiger mit dem Teleskop als mit dem Fernglas beobachtet, wird damit bald zurecht kommen. Andere fühlen sich gelegentlich wie vor einem Bild von Baselitz. Ein kopfstehendes Bild macht eben einen ganz anderen emotionalen Eindruck. Man verfolge nur einmal in einer Nacht - oder mit dem Planetariums-Programm - den Weg von Ursa Major um Polaris.
Dank technischer Fortschritte können wir heute problemlos Skizzen eines Himmelsausschnitts über Screenshots von einer App und mit speziellen Aufsuchkarten-Programmen wie "Eye & Telescope" erstellen. Das hat durchaus seine Berechtigung und seinen Nutzen - aber die eigene Zeichnung, mit Datum und Ort der Beobachtung und einigen textlichen Erläuterungen, ist als Sehschulung und Erinnerungshilfe einiges tauglicher. Allerdings auch mühsamer.
Der Hinweis auf Goethe verweist noch auf eine dritte Dimension des astronomischen Zeichnens. Goethe hatte noch keinen Fotoapparat, geschweige denn ein Smartphone mit Kamera. In der Astronomie sind wir in einer ähnlichen Situation, auch wenn wir mit der Astrofotografie durchaus festhalten können, was wir sehen. Dieses Festhalten ist jedoch vielfach technisch vermittelt und abstrakt. Vielleicht holen wir uns mit der Zeichnung etwas von der Sinnlichkeit des Sehens zurück, die unter EEA verloren zu gehen droht. Die wunderbaren astronomischen Skizzen von Ferenc Lovró können davon eine Ahnung geben. Sie zeigen uns auch, was "wirklich" zu sehen ist (bei Lavró durch einen 12-Zöller), nicht Produkte der Astrofotografie, die mit dem Anblick durch die Teleskopoptik nur wenig gemeinsam haben.
8.3 Eigenbau
Ehe die chinesische Produktion den Markt mit günstigen
Teleskopen flutete, war der Selbstbau in der
Astronomen-Szene weit verbreitet. Wobei es vor allem Newtons
waren, die gebaut wurden. Spiegel wurden selbst geschliffen
und aus Hartholz wurden rustikale parallaktische
Montierungen geschraubt, etwa nach den Vorgaben von Wolfgang
Schroeder ("Praktische Astronomie für Sternfreunde", 1960).
Im angelsächsischen Bereich heißt die Selbstbau-Bewegung ATM
(Amateur Telescope Making). Sie nahm in den 1920er Jahren
ihren Anfang.Geblieben ist davon bis heute der Dobson-Bau. Der/das Dobson ist eine besonders effektive und preisgünstig zu bauende Newton-Variante, die von John Dobson in den 1950er und 1960er Jahren in seiner Klosterzeit als Ramakrishna-Mönch entwickelt wurde. Sein Interesse an Kosmologie zusammen mit seinem Armutsgelübde hatten ihn veranlasst, Teleskope aus Abfallmaterialien zu bauen. Dobson wurde 1915 in China geboren, wo sein Vater als Wissenschaftler arbeitete. 1927 kehrte die Familie in die USA zurück. Dort schloß der Sohn 1943 ein Chemiestudium ab und trat 1944 dem Ramakrishna-Orden bei. Bis 1967 lebte er im Vedanda-Kloster San Francisco. Danach gründete er die "Sidewalk Astronomers" in San Francisco mit. Er starb 2014 in Kalifornien.
Aus der Selbstbau-Szene entstanden auch bemerkenswerte Kleinfirmen. Unvergesslich bleibt der 8-Zoll-Reisedobson von "Hofheim Instruments", die 2020 die Produktion einstellten. Auch der 8-Zöller von Reinhard Schulten wurde sehr gelobt, ist aber gleichfalls nicht mehr zu bekommen. Reise-Dobsons von 10 bis 30 Zoll baut noch Dieter Martini in Zeltingen-Rachtig an der Mosel nach frei wählbaren Komponenten. "Spacewalk Telescopes" in Karlsruhe produziert Dobsons von 16'' bis 25''. Das Gesamtgewicht des größten Exemplars beträgt etwa 63 Kilogramm. Die Kosten nähern sich der 20.000-Euro-Grenze, allerdings ermöglicht solch ein Gerät Spaziergänge in Galaxienhaufen, die 1.000 Millionen Lichtjahre von uns entfernt sind.
Ganz am anderen Ende der Preisskala ist der Bastelsatz für ein "Baumarkt-Teleskop" von AstroMedia angesiedelt. Für 20 Euro plus Kosten für das Rohr aus dem Baumarkt kann hier Selbstbau-Feeling geschnuppert werden, mit 30-facher Vergrößerung dank Plössl-Okular.
8.4 Quadratur des Kreises
Die Basteleien erschöpfen sich nicht im Selbstbau des Teleskops. Das Basteln gehört wohl zur Talente-Grundausstattung eines jeden Astronomen - und Karolina Lucrezia Herschel, die um 11 Jahre 4 Monate jüngere Schwester von Friedrich Wilhelm Herschel, zeigte schon früh, dass dies nicht nur Männer betrifft. Der Überlieferung zufolge habe sie nur die Linsen geschliffen, eigene Beobachtungen angestellt und Systematisierungen geleistet. Doch es ist auch von einem substantiellen Beitrag zum Bau der Beobachtungsinstrumente auszugehen, denn ihr handwerkliches Geschick wurde in der Familie sehr gelobt.Grundlegende Baubemühungen in Hobby-Astronomenkreisen scheinen der Quadratur des Kreises zu gelten. Statt Astrofotografie mit einem kontraststarken Linsenteleskop auf parallaktischer Montierung zu betreiben werden Dobsons mühevoll zugerüstet, um mit ihnen zu fotografieren. Viel Bastelfleiß fließt auch in den quasi-parallaktischen Umbau azimutaler Montierungen. Aus Sucherfernrohren werden Kameraoptiken, aus Kameras Sucherfernrohre. Allerdings mit unschätzbarem Erfahrungsgewinn und unbedingtem Spaß. Und eben gelegentlich auch mit der Erschließung neuer Möglichkeiten und Qualitäten. Einfach kann schließlich jeder.
Vieles erinnert auch an die unter Sufis verbreitete Verbindung der getrennten Essenzen. Wo z.B. Oliven entölt, gedörrt und dann mit Olivenöl zusammen gebracht werden zum rituellen Genuss. Im Ausrüstungsbau der Himmelsbeobachtung entspricht dem etwa die immer extremere Verschlankung von Dobsons in der Leichtbauweise (Flextube oder Gitterrohr) - um dann dem Dobson einen Mantel gegen Wind, Feuchtigkeit, Staub und Fremdlicht umzuhängen, der nicht zu leicht sein darf, da er sonst ins Bild flattert. Und die Rockerbox muss das fehlende Gewicht des Dobson für die Stabilität ausgleichen. Aber auch hier gibt es einen ganz klaren Gewinn, die bessere Transportierbarkeit. Wie beim Olivenbeispiel die bessere Haltbarkeit der getrennten "Essenzen".
8.5 Isaac Newton
Wir alle benutzen seinen Namen in der Astronomie ständig,
wenn von "Newtons" oder "Newton-Reflektoren" die Rede ist,
dem wichtigsten Typus der unter Amateur-Astronomen
gebräuchlichen Teleskope. Aber was wissen wir noch von ihm,
außer dass er das Gravitationsgesetz gefunden haben soll,
als ein Apfel vom Baum fiel?Isaac Newton (1643-1727) war einer der klügsten Köpfe seiner Zeit und kannte sich in der Naturphilosophie ebenso gut aus wie in den Naturwissenschaften - die noch nicht klar geschieden waren. Erst nach ihm wurden die beiden Bereiche immer schärfer getrennt. Newton selbst hatte auch keine Probleme damit, sich intensiv mit der Alchimie zu befassen. Und das theologische Schrifttum machte 27% seiner nachgelassenen Bibliothek aus. Sein Kollege Johannes Kepler hatte sich auch als Astrologe betätigt - fürchtete allerdings weit mehr als Newton die Macht der Kirche. Keplers Mutter war 1616 nur knapp einem Hexenprozess entronnen, er selbst hatte zahlreiche Repressalien von Seiten der evangelischen Kirche zu ertragen (trotz - oder gerade wegen seines Studiums am Tübinger Theologen-Stift?).
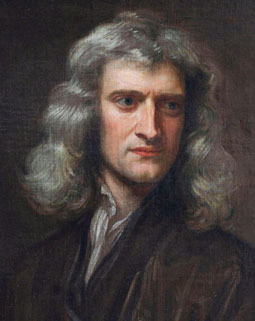
Newtons Beiträge zur Astronomie sind einmal die Formulierung des Gravitationsgesetzes, einmal die Analyse der Lichtzusammensetzung. Seine Entdeckung der Gravitation wurde anekdotisch auch von ihm selbst auf den Anblick eines fallenden Apfels zurückgeführt. Aber natürlich stand dahinter intensive Forschungsarbeit, unter anderem die Beschäftigung mit Keplers Berechnungen der Planetenbahnen. Newton formulierte das Gravitationsgesetz, das die hinter Keplers drei Gesetzen stehende Ursache ausmachte und die Tür öffnete für ein fundiertes Verständnis der Himmelsmechanik.
Für die Optik bewies Newton die Zusammensetzung des weißen Lichtes aus Farblichtern und was dies für Linsenteleskope bedeutet, nämlich Farbsäume. Dies veranlasste ihn, die Entwicklung des Spiegelteleskopes weiter voranzutreiben. Zu seiner Zeit waren Spiegelteleskope mit leicht gekipptem Spiegel bekannt. Das erste Modell hierzu wurde von dem Jesuitenpater Nicolaus Zucchius/Niccolò Zucchi 1616 vorgestellt. Newton konnte die erheblichen Abbildungsfehler dieser Konstruktion vermeiden durch die Einführung eines zweiten Spiegels (der erste Spiegel wird nun zum Primärspiegel/Hauptspiegel), eines Umlenkspiegels, in den Tubus. Seine Konstruktion von 1668 hat bis heute Bestand. In großen Sternwarten wird allerdings der kurz nach dem Newton-Typus 1672 entwickelte Spiegelteleskop-Typus von Laurent Cassegrain verwendet. Da geht das Licht vom Sekundärspiegel (Fangspiegel, Umlenkspiegel) durch eine kleine Öffnung im Hauptspiegel zum Okular.
Newtons Modell hat den Vorteil für Amateure, dass der Einblick für den Betrachter seitlich in Objektivnähe angebracht ist. Ein unschätzbarer Gewinn vor allem bei den großen Standteleskopen, den Dobsons.
Persönlich war Newton wohl ein eher unfreundlicher Zeitgenosse, mit einer problembeladenen Kindheit im Hintergrund. Konkurrenten wie Leibniz verfolgte er mit böswilligem Eifer auch noch nach ihrem Tode, als Direktor der Königlichen Münzanstalt brachte er zahlreiche Fälscher, auch unbedarfte Kleinkriminelle, an den Galgen.
8.6 Sternwarten des Vatikans
1578 ließ Papst Gregor XIII. den "Turm der Winde" ("Torre
dei Venti") im Zentrum der Vatikanstadt bauen. Er diente
Jesuiten für astronomische Beobachtungen und Berechnungen
zur Kalenderreform des Papstes. Mit den "Ketzereien" des
Galileo Galilei wurde das Gebäude auch zu
Himmelsbeobachtungen genutzt, die Galilei widerlegen
sollten. Der Jesuit Christoph Grienberger hatte die
Beobachtungen Galileis zu beurteilen und kam in erhebliche
Gewissensnot, da er Galilei inhaltlich recht geben musste,
wie er dem Freund in einem Brief bekannte. Grienberger hatte
auch einen Vorläufer der parallaktischen Montierung zur
Sonnenbeobachtung mit dem "Helioskop" entwickelt. Es ist
davon auszugehen, dass er auch für Fernrohre Ähnliches
baute, dies aber nicht an die Öffentlichkeit drang.1789 wurden die Einrichtungen im Turm der Winde offiziell zur "Specula Vaticana" erklärt. Daneben gab es seit 1774 (bis 1878) das Observatorium im jesuitischen Collegio Romano. In der Mitte des 19. Jahrhundert klassifizierte der Jesuit Angelo Seechi im Collegio Romano die Sterne nach ihrer Spektralanalyse und wurde damit zum Begründer der Astrophysik. Papst Leo XIII. rief nach einer Phase der Stagnation die "Specola Vaticana" im Jahr 1891 auf einem Hügel hinter dem Petersdom neu ins Leben. In der Stadt war es definitiv zu hell geworden für eine Sternwarte.
Die zunehmende Lichtverschmutzung zwang bald darauf erneut zum Umzug. Unter Pius XI. wurde die Sternwarte des Vatikans auf das Gelände der Päpstlichen Sommerresidenz in Castel Gandolfo verlegt und mit zwei neu konstruierten Teleskopen in den 1930er Jahren in die Obhut der Jesuiten gegeben. 1960 ermunterte Papst Johannes XXIII. die Astronomen der Sternwarte dazu, der Kirche die Astronomie und den Astronomen die Kirche zu erklären. 1981 gab es eine von Jesuiten geleitete Konferenz zu kosmologischen Fragen und der Papst erklärte, die These vom Urknall ließe sich sehr wohl mit göttlicher Schöpfung verbinden. Die Licht- und die Luftverschmutzung machten jedoch auch vor Castel Gandolfo nicht Halt und so zog im Jahr 1991 zumindest das Teleskop des Vatikans erneut um, in das "Mount Graham International Observatory" in Arizona. Seine Bezeichnung heute lautet "Vatican Advanced Technology Telescope".
8.7 Einsatz gegen Lichtverschmutzung
Astronomen wird gerne eine unpolitische Weltferne oder
gar Weltflucht nachgesagt. Das begann schon vor mehr als
2000 Jahren mit der Anekdote zu Thales von Milet, der beim
Betrachten der Sterne in einen Brunnen gefallen und darob
von seiner Magd Thratta ausgelacht worden sei, weil er
sich wohl mit den Dingen am Himmel auskenne, aber das
Naheliegende übersehe.
In einem Belang zumindest kümmern sich Astronomen aber
sehr wohl auch um das Naheliegende: Wenn es um die
Lichtverschmutzung geht. Die bedroht nicht nur unsere
Gesundheit und unsere Lebensqualität allgemein, sie
gefährdet nicht nur die Lebensweise und konkret auch das
Leben von Insekten, Vögeln und anderen Tieren, sie
verschlingt nicht nur Unsummen an seltenen Rohstoffen und
Energie - nein, sie macht zunehmend auch die Ausübung der
Astronomie als Hobby und Profession schwierig bis in
weiten Bereichen unmöglich! Bedenken wir, was Charles
Messier mit seinen 3''-Fernrohren zu sehen vermochte und
vergleichen wir das mit dem, was an einem "normalen"
Zivilisationshimmel mit 75mm-Objektiven noch zu sehen ist!
Einer der wichtigsten und einflussreichsten Kämpfer gegen
die Lichtverschmutzung ist Hans-Ulrich Keller, der
Gründungsdirektor des Carl-Zeiss Planetariums Stuttgart
und Herausgeber des Kosmos-Jahrbuchs "Himmelsjahr". Der
Schwerpunkt seiner einschlägigen Aktivitäten lag in den
Jahren 2000 bis 2010, mit zahlreichen Veröffentlichungen
und seinem Beitrag zur "Umweltnacht" Stuttgart 2006.
Wichtig für Deutschland ist auch die "Initiative gegen
Lichtverschmutzung" der Fachgruppe "Dark Sky" in der
"Vereinigung der Sternenfreunde" e.V., die vor allem
zwischen 1998 und 2017 aktiv war und eine zu diesem
Zeitraum sehr informative Website mit der Adresse
"lichtverschmutzung.de" unterhält.
Die Lichtverschmutzung hat trotz dieser Aktivitäten in
fatalem Maße zugenommen. Die öffentliche Hand ist zwar
sensibler geworden, es gibt Einschränkungen, vor allem für
den Insektenschutz. Aber die inzwischen groteske Züge
annehmende Lichtverschmutzung durch Privathaushalte macht
viele der ohnedies eher bescheidenen Erfolge (etwa bei der
öffentlichen Straßenbeleuchtung) zunichte. Da flammt im
schon mit Rindenmulch, Schotter oder gar Kunstrasen
abgetöteten "Garten" des nachts bei jeder
vorbeischleichenden Katze eine Flutlichtbeleuchtung auf.
Da wird im Ort zu jedem runden Geburtstag und jeder
Hochzeit ein Feuerwerk abgebrannt oder ein Himmelslaser
losgelassen. Da versinken zu Weihnachten und Ostern und
zunehmend auch anlasslos (LED-Licht ist ja sooo billig im
Verbrauch) Gebäude und Vorgarten unter Lichterketten. Dazu
kommt noch der Trend zu großen Fenstern und Glasfronten -
ohne Rolläden. Wie es scheint, wollen viele am liebsten
"draußen" leben - aber schön bequem, sicher und sauber,
wohl temperiert und voll ausgeleuchtet.
Verhalten optimistisch stimmen Engagements wie die der Stadt Fulda, die zunächst aus ökologischen Gründen, dann auch mit dem Fokus auf Astronomie der Lichtverschmutzung Einhalt gebot und die 2019 von der International Dark-Sky Association das Prädikat "Dark-Sky-Community" erhielt.
Ein weiteres, allerdings weit weniger gewichtiges
Politikum für Hobbyastronomen ist die Sommerzeit. Für
diejenigen, die morgens zur Arbeit müssen, bedeutet diese
eine Stunde weniger Beobachtungszeit in der Nacht.
8.8 Therapeutikum Sternenhimmel
"everybody may be and ought to be, in a
modest, personal way,
an astronomer, for star-gazing is a great medicine
of the soul"
Philip S. Harrington 2011
Dass Licht eine therpeutische Wirkung hat, ist lange bekannt. Am deutlichsten wird es bei der wärmenden Infrarotstrahlung. Aber auch die Wirksamkeit von Sonnenlicht allgemein auf die Drüsen des Gehirns (Hypophyse, Zirbeldrüse) und damit unser körperliches und seelische Befinden ist offenkundig. Welche Anteile dabei direkte Einwirkungen oder die neuronale Verarbeitung über die Netzhautaufnahme haben, ist strittig. Die Regelfunktion des Mondes für die Menstruationszyklen oder sein Einfluss auf psychiatrische Formenkreise lässt direkte Einwirkungen vermuten, eventuell auch über gravitative Funktionen. Die positive Wirkung von Brillen mit Orangefilter auf bipolare Störungen über den optischen Kanal ist hinreichen durch Untersuchungen belegt.
Neuere schlafmedizinische Forschungen, etwa von Christian Cajochen, Leiter des Zentrums für Chronobiologie an der Universität Basel, oder von Ingo Fietze an der Charité, weisen auf eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür hin, dass auch der Anblick des Sternenhimmels seelisch regulierend, entspannend und schlaffördernd wirkt. Ich selbst mache diese Erfahrung regelmäßig. Eine Rolle spielen kann dabei natürlich auch der abendliche/nächtliche Aufenthalt an der frischen Luft bei Dunkelheit und Ruhe - statt z.B. vor dem Computer oder unter der 100-Watt-Äquivalente-Wohnzimmerlampe. Auf diese drei Faktoren, Aufenthalt im Freien, Stille und Dunkelheit, für eine gute Schlafvorbereitung weisen Fietze und Cajochen nachdrücklich hin, im Kontext chronobiologischer Erörterungen. Die Entwicklung eines Bewusstseins für natürliche Rhythmen und für unseren Biorhythmus im Besonderen ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für guten Schlaf. Als Astronomen unterm Sternenhimmel sind wir dafür gut aufgestellt - sofern wir nicht hektisch mit Laptop und Smartphone hantieren und uns nicht gleich die ganze Nacht um die Augen schlagen.
Daher Obacht geben, wenn wir mit EAA das Hobby zunehmend in einen Computer-Arbeitsplatz verwandeln. Gerade haben vier Physiker ein Gerät entwickelt, das die Dominanz der Elektronik über die Optik verkündet: Das Unistellar eVscope. Vorläufig (Stand Anfang 2022) sind sicherlich nur wenige bereit, für ein Teleskop 3000 Euro auszugeben, das in der optischen Leistung weit hinter einen Tubus für 500 Euro zurückfällt. Doch der Preisverfall für solche Modelle ist abzusehen, dann fällt die Anschaffung leichter. Und dann muss jeder für sich schauen, ob ein eVscope oder ein Fernglas besser ist vor dem Schlafengehen.
Dass unser Unterbewusstes auf den Anblick der Sterne reagiert, ist verständlich angesichts der Tatsache, dass bis vor etwa 100 Jahren der Anblick des Sternenhimmels für unsere Vorfahren über Jahrhunderttausende emotional hoch aufgeladene Allnachtserfahrung war - heute ausgelöscht durch Lichtverschmutzung, Aufenthalt in geschlossenen Räumen und Konsum technischer Medien am Abend. Als Alternative zum Fernsehprogramm vor dem Schlafengehen werden inzwischen künstliche Sternhimmel angeboten, gemalt, mit Leuchtketten simuliert oder als Lichtprojektion. Häufig ausdrücklich gepriesen als Einschlafhilfen! Für Hobbyastronomen sind darunter auch in anderer Hinsicht interessante Angebote wie die durchaus ernstzunehmenden Klein-Planetarien von Bresser und Sega.
8.9 Astronomie und Körperbild
Es liegt zunächst nahe, die Astronomie als ganz vom Augensinn dominiert anzusehen. Und das fängt schon an damit, dass Galilei sein erstes Teleskop (als Nachbau der Erfindung von Hans Lippershey) mit Brillengläsern konstruierte.Wir leben heute dank der elektronischen Medien in einer durch und durch von Bildern geprägten Alltagswelt. Und Theorien wie die vom "pictorial turn" (Thomas Mitchell 1992) oder "iconic turn" (Gottfried Boehme 1994) haben die Überzeugung verfestigt, dass Bilder unsere Weltsicht heute bestimmen, nicht Sprache oder Handeln, um zwei der am häufigsten thematisierten Gegenspieler zu nennen. Astronomie erscheint vor diesem Hintergrund als eine in besonderem Maße "zeitgemäße" Beschäftigung.
Dass der Augensinn für die Entwicklung der Menschheit einer der prägenden Sinne ist, steht außer Zweifel. Allerdings sollte uns stutzig machen, dass die zentrale Tätigkeit mentaler Welterschließung mit dem "Begreifen" operiert, einer Tätigkeit, die schon in ihrer Bezeichnung die Bedeutung der tätigen Hand herausstreicht. Und in der Tat: Wäre der Sehsinn der dominierende, lebten wir z.B. in einer kopfstehenden Welt. Unsere Augen drehen das sichtbare Bild und projiziert es so auf die Netzhaut. Erst die haptisch-bewegungsorientierte Erfahrung hat unser kopfstehendes Augenbild in der frühen Kindheit auf die Füße gestellt. Auch korrektes Sehen ist also auf das Greifen angewiesen.
Von daher entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass kopfstehende Bilder für Astronomen seit Newton Teil der Beobachtungserfahrung sind. Objekt unserer Leidenschaft ist eine "unbegreifliche" (im konkreten Wortsinn) Welt. Unsere Hände können nicht nach den Sternen greifen, unsere Füße uns nicht dorthin führen. Und da draußen gibt es kein Unten und Oben. In mehreren berühmten Experiment hat der Psychologe George Stratton zuerst in Leipzig bei Wundt, dann in Berkley die Welt einige Tage so gesehen, wie wir ohne Amici-Prisma oder Zenitspiegel den Himmel mit einem Reflektor sehen. Seine Erfahrung: wir benötigen das Tasten und die Bewegung, um uns neu orientieren zu können. Eines der Hobbies von Stratton war übrigens das Bauen von Mauern, ein elementares Hand-Werk.
Und wie steht es mit der Astronomie? Ist es wirklich das Sehen alleine, was ihre Erfahrung und ihre Faszination ausmacht? Wäre dem so, könnten wir uns ja mit Abbildern begnügen. Von denen gibt es genügend und in einer Qualität, die wir mit unseren Amateur-Ausrüstungen kaum erreichen - und schon gar nicht in der Betrachtung, am ehesten noch in der Astrofotografie. Astronomie ist Handeln, ist Umgang mit dem Gerät, Suchen, Auffinden. Ist aktive Praxis, nicht bloß konsumierendes Sehen. Daran sollten wir immer denken, wenn EAA-Angebote uns locken mit den Tausenden von Objekten, die sie uns bieten zum Konsum. Und wir verstehen, welchen Grund die Sternbilder der Menschheit auch hatten: Sie stellten den Himmel auf den Boden für seine menschlichen Betrachter, sie gaben ihm Hände und Füße.
Daher kommen die meisten Himmelsbeobachter früher oder später zum Fernglas als wichtigem Beobachtungsinstrument - wenn sie damit nicht ohnedies schon begonnen haben. Es ist gut zu handhaben, gezielt zu führen und nahe am "realen" Himmelsanblick. Es ermöglicht sinnliche Spaziergänge am Himmel, als seien wir einfach nur ein wenig näher gerückt, als könnten wir die Objekte fast berühren, doch ohne die Orientierung zu verlieren. Und auch die Faszination von Dobsons dürfte sich zumindest zu einem Teil der haptischen Dimension unseres Weltumgangs verdanken. Auch wenn wir im Dobson in Welten fern unserer primären Wahrnehmung geführt werden ist ein zentraler, emotional aufgeladener Begriff des Dobson-Gebrauchs das "Schubsen".
Astronomie lebt von den Dimensionen jenseits der Flächigkeit von Bildern. Und auch das fing schon mit Galilei an. Seine Entdeckungen haben das zweidimensionale "offizielle" Weltbild der Kirche durchbrochen.
8.10 Konjunktionen und Oppositionen
Konjunktionen sind die von der Erde aus gesehenen optischen
Näheverhältnisse einzelner Himmelsobjekte durch eine
Elongation nahe Null. Die bekannteste Konjunktion ist die
von Jupiter und Saturn, auch "Große Konjunktion" genannt.
Oppositionen sind Platzierungen von Planeten auf einer Linie
mit Erde und Sonne, wobei die Erde in der Mitte steht. Beide
Phänomene sind sowohl in der Astronomie, als auch in der
Astrologie von Bedeutung. Für die Amateurastronomie schaffen Konjunktionen oft interessante Beobachtungsbedingungen, vor allem für die kleinen Planeten. Die letzte Große Konjunktion fand am 21. Dezember 2020 statt, mit 6 Bogenminuten Abstand. Die nächste wird am 31. Oktober 2040 stattfinden, bei einer Periodizität von annähernd 20 Jahren. Johannes Kepler hat 1603 eine Große Konjunktion zusammen mit einer Supernova beobachtet und dies mit dem "Stern von Bethlehem" in Verbindung gebracht.
Konjunktionen vermitteln - in der Verbindung von Sinneswahrnehmung und Wissen - einen räumlichen Eindruck des ansonsten eher flächig wahrgenommenen "Himmelszeltes". In der Konjunktion von Mond und Mars etwa sehen wir besonders intensiv erfahrbar in die Tiefen des Weltraums. Denn wir wissen, dass der kleine Lichtpunkt neben dem uns so nahen Mond in Wirklichkeit etwa 3,9 mal so groß ist im Durchmesser und etwa 180 mal so weit entfernt von uns. Mit diesem Wissen verändert sich die Nebenordnung zur perspektivischen Ordnung, wie in einem Vexierbild.
Oppositionen bieten uns die Planeten in einer besonders starken Helligkeit. Die bekannteste Opposition ist der Vollmond, der gelegentlich allerdings ausfällt, wenn Erdbahn und Mondbahn in einer Ebene liegen, dann steht der Mond im Erdschatten und wir haben eine Mondfinsternis, die den Erdschatten allmählich über den Vollmond schiebt und damit gleichfalls wieder eine räumliche Imagination schafft.
In der Astrologie werden den beiden Phänomenen besondere Bedeutungen und Einflüsse auf den Menschen und das Schicksal zugesprochen. Die Konjunktion gilt als der stärkste Aspekt (Winkelbeziehung). Die Große Konjunktion von 1524 war verbunden mit einer Versammlung von Merkur, Venus und Mars. Sie wurde als besonders bedeutendes Mahnzeichen interpretiert. Der Astronom Johannes Stöffler sah eine Sintflut kommen, der Astrologe Johannes Virdung prophezeite die Ankunft des Antichristen. Für die Anthroposophie ist die Große Konjunktion ein "Ruf des kosmischen Ich".
Auch die Opposition gehört zu den wichtigsten Aspekten in der Astrologie. Wie zu vermuten, weist sie für die Astrologenzunft auf Konflikte, Spannungen zwischen den Kräften hin, die den in Opposition stehenden Elementen zugesprochen werden.
8.11 Astrologie
"Ist es nicht überdies eine anerkannte
Tatsache, dass die Astronomie aus der Astrologie, die
Chemie aus der Alchimie hervorgegangen ist?
Aber man deutet diese Nachfolge als einen
Fortschritt, während es sich um einen Verfall der
Aufmerksamkeit handelt." - Simone Weil
Astronomie und Astrologie waren zu Beginn der menschlichen Beschäftigung mit den Himmelsobjekten noch nicht getrennt. Welchen konkreten Hintergrund die Sternkonstellationen in der Höhle von Lascaux haben, einen eher astrologisch-magischen oder einen eher astronomisch-kalendarischen, wissen wir nicht. Identifizierbar sind die Plejaden im "Saal der Stiere". In Mesopotamien hatte die Astronomie-Astrologie erkennbar ab etwa 2.500 vor Christus auch die Funktion, landwirtschaftlich relevante Daten bereitzustellen. Regelmäßig wiederkehrende jahreszeitliche Veränderungen wurden verbunden mit bestimmten Stern- und Planetenkonstellationen. Es ist davon auszugehen, dass als Folge dieser Erfahrungen Himmelsereignisse als Vorboten und Mitteilungen auch anderer als klimatisch-landwirtschaftlich relevanter Ereignisse angesehen wurden. Wichtig wurde dabei die Verbindung des Naturgeschehens am Himmel mit numerischen und geometrischen Aufzeichnungen und Berechnungen. Es könnte durchaus sein, dass hier streng genommen die Astronomie der Astrologie vorausgegangen ist.
Die griechisch-alexandrinische Antike verknüpfte dann die babylonischen Sternbilder (kodifiziert um ca. 700 v. Chr.) und die angesammelten astronomischen Kenntnisse der syrisch-mesopotamisch-babylonischen Region mit den ägyptischen Vorstellungen von der Schöpfungsordnung und der sphärischen Organisation des Kosmos sowie den griechischen Auffassungen vom göttlich gelenkten Schicksal und von der Vier-Elemente-Lehre. Dabei entstanden die ersten prognostischen Individual-Horoskope. Als Aufzeichnungen ohne Deutung (nach heutigem Kenntnisstand) wurden sie schon in Babylonien erstmals mit der Geburtskonstellation des "Sohnes von Shumar-usur" 410 v. Chr. in Stein gehauen.
Kurz vor der Zeitenwende machten sich der Legende zufolge drei Astronomen-Astrologen aus dem "Morgenland" - vermutlich dem Raum des heutigen Iran oder Irak - auf den Weg, um dem "Stern von Bethlehem", nach frühen Spekulationen und heutigem Kenntnisstand entweder die Bahn eines Kometen oder eine Große Konjunktion von Jupiter und Saturn, ans Mittelmeer zu folgen.
Im Römischen Reich verflachte die Astrologie nach der Zeitenwende auf das Niveau heutiger Zeitungshoroskope. Aus dem Mittelalter ist das Fortleben der Astrologie bekannt, trotz überwiegender Distanz auch in kirchlichen Kreisen. Augustinus etwa legt davon kritisch Zeugnis ab in seinen "Bekentnissen" im 4. und im 7. Buch. Im ausgehenden Mittelalter und in der Renaissance erlebte die Astrologie eine Neubewertung und Aufwertung. Auch das Papsttum vertraute ihr nun weitgehend, Papst Leo X. richtete 1520 an der päpstlichen Universität Thomas von Aquin gar einen Lehrstuhl für Astrologie ein. Die gleichfalls neu belebte Disziplin der Astronomie knüpfte zunächst an die alte Tradition einer engen Verbindung mit der Astrologie an. So waren Tycho Brahe und Johannes Kepler auch praktizierende Astrologen. Kepler sagte Ereignisse des Türkenkriegs 1593-1606 voraus und erstellte ein erstes Horoskop für Albrecht von Wallenstein 1608. Keplers Auffassung gegenüber Wallenstein, der klare Prognosen erwartete, war allerdings: "Die Sterne zwingen nicht, sie machen nur geneigt." - Ein Satz, der auch Albertus Magnus, Thomas von Aquin und Shakespeare zugeschrieben wird. Von Kepler ist auch der Satz überliefert, die Astrologie sei das "närrische Töchterlein der Astronomie".
Dazu eine bemerkenswerte Stelle aus Augustinus, Bekenntnisse, 7. Buch, in der er sich auf Aussagen seiner Freunde Vindicianus und Nebridius bezieht: "eine wirkliche Kunst der Vorschau in die Zukunft gebe es überhaupt nicht, es handle sich um rein menschliche Mutmaßungen, bei denen oft der Zufall die Rolle des Orakels spiele, und wer vieles sage, sage allerlei, was hinterher eintreffe" (nach der Übersetzung von Joseph Bernhart). Dies sei erinnert in Zeiten, die wieder zahlreiche Propheten (ohne Berufung auf die Astrologie allerdings) auch in verantwortlichen Positionen hervorbringen mit der Klima-, der Corona- und der Ukraine-Krise, Propheten, die "allerlei" sagen. In seiner Jugend hat Augustinus nach eigenem Bekenntnis im 4. Buch Astrologen (bei ihm heißen sie "mathematicos") häufig zu Rate gezogen, da es bei ihnen weder Tieropfer noch Gebete an Geister gebe.
Mit der massiven Ablehnung zugleich durch die Reformation und die gegenreformatorischen Jesuiten verlor die Astrologie im 17. Jahrhundert an Legitimation. Die Jesuiten förderten stattdessen nachdrücklich die Astronomie. Newton beschäftigte sich zunächst 1662 mit der Astrologie, fand ihre Berechnungen und Ableitungen allerdings abstrus. Sein Interesse galt fortan der Mathematik, der Physik und der Astronomie - was ihn nicht hinderte, sich zeitlebens auch intensiv mit theologischen Fragen und mit der Alchimie auseinander zu setzen. Im 18. Jahrhundert wurde die Astrologie dann unter dem Einfluss der Aufklärung aus den Universitäten verbannt. Seitdem ist sie in wechselnder Intensität fester Bestandteil der Alltagskultur und in verschiedenen Subkulturen prägend präsent.
In der Astronomie ist ihre Präsenz durchaus auch heute noch zu ahnen. Wenn von "Opposition", "Konjunktion" und Ähnlichem die Rede ist, spüren wir noch etwas vom Raunen magischer Vorstellungen. Eine "Konjunktion" z.B. ist schließlich nichts weiter als eine besonders auffallende optische Nähe (im Extremfall die Überlappung) zweier oder mehrerer Objekte für den Blick von der Erde aus.
Festzuhalten ist, dass unter "Astrologie" zu verschiedenen Zeiten und bei verschiedenen Personen Unterschiedliches gemeint ist. So hatte z.B. Kepler offenkundig eine ganz andere, weit differenziertere Auffassung von Astrologie als sein "Klient" Wallenstein.
8.12 Das Evangelium am Himmel
Der Theologe und Hobby-Astronom Joachim Barth
veröffentlichte 2023 ein Buch mit dem etwas ausufernden
Titel "Das Evangelium am Himmel. Kosmische und astrale
Aspekte der Offenbarung des Johannes unter besonderer
Berücksichtigung ihrer kosmischen Christologie". Darin führt
er den gesamten Aufbau der Offenbarung des Johannes, der
"Apokalypse", zurück auf die Anordnung von Sternbildern und
Planeten. Er folgt damit älteren Ansätzen der
Aufklärungszeit und der religionshistorischen Schule des 19.
Jahrhunderts, die astrale Elemente in der Offenbarung
bereits identifiziert hatten - allerdings darin vorwiegend
unsystematische Übernahmen aus antiken oder babylonischen
Überlieferungen sahen, die Johannes nur als
Darstellungshilfen zur Beschreibung seiner Visionen
eingesetzt habe. Am weitesten ist vor Barth der Altphilologe
und Astrologie- sowie Astronomiehistoriker Franz Boll
gegangen mit seiner Publikation "Aus der Offenbarung des
Johannis". Aber auch er sieht keine konsequente Gestaltung
der Offenbarung nach Himmelsbildern.Anders Joachim Barth, dessen Ausgangsthese lautet, dass Johannes in der Apokalypse grundsätzlich versuche, "die gegenwärtige Welt von einer kosmisch und astral geprägten Tiefenschicht her zu begreifen" (Barth 2023, S. 25). Barth unternimmt, weit über seine Vorgänger hinausgehend, den Versuch, "das Ganze der Offenbarung vor einem stellaren Hintergrund zu erklären". Und er schließt: "Für mich ist Johannes ein Astrotheologe, der die Sternbilder im christlichen Kontext zum Sprechen bringen möchte." (Barth 2023, S. 28). Vor diesem Hintergrund werden in seiner Publikation 35 ptolemäische Sternbilder differenziert analysiert, für die übrigen gibt der Autor (mit Blick auf eine Nachfolgepublikation) Hinweise, wo der Bezug zu den Sternbildern in der Offenbarung des Johannes liegen könnte (s. Barth 2023, S. 687ff).
Exemplarisch sei hier das Sternbild Perseus vorgestellt. Barth sieht in ihm das Bild für den "Thronenden", den Pantokrator bei Johannes, Offenbarung 4. Wie "Jaspis- und Sardisstein" sei dieser erschienen, was der Autor mit den Farben des Sternes Epsilon Persei und des Kaliforniennebels verbindet. Den "Regenbogen", der den Thron rings umzieht bei Johannes identifiziert er mit den Sternen der Milchstraße, die sich über Perseus prägnant zeigt. Das Siebengestirn der Plejaden steht Barth zufolge für die "sieben Fackeln" vor dem Thron Gottes. Offen lässt er, ob der Pantokrator für Johannes im Sternbild Perseus mit dargestellt sei oder nur der Thron - und wir uns gegebenenfalls Gott als nicht unmittelbar sichtbar im Hintergrund denken müssen. Besonders betont er die Stellung des Sternbildes am Schnittpunkt zweier Weltachsen, der Achse der Präzession und die Achse durch den Zenit. "Im Sternbild Perseus zeigt sich für Johannes die Macht Gottes, seine Allmacht als 'Hüter' der beiden Weltachsen" (Barth 2023, S. 194). zu erkennen Mitte August beim Sonnenaufgang und Mitte September beim Sonnenuntergang, wenn Perseus im Zenit steht (s. Barth 2023, S. 192). Für den religiös-kultischen Bezug des Sternbildes Perseus kann Barth auch zahlreiche historische Belege beibringen, aus dem Mithraskult und aus einer christlichen "Irrlehre", die der frühchristliche Theologe Hippolyt von Rom in seiner "Refutatio omnium haeresium" behandelt.
Der Bezug zwischen Religion und Sternenhimmel ist weit verbreitet. Wir finden ihn in den ägyptischen Totenbüchern, wo die Reise durch die Jenseitswelt dem Sternenhimmel folgt, ausgemalt in vielen Grabkammern, erhalten nur in Fragmenten. Die Gewölbedecken der Mithras-Heiligtümer waren mit einem Sternenhimmel ausgemalt, auch der Mantel des Mithras trug in der Innenseite einen Sternenhimmel. Auch in christlichen Kirchen sehen wir gelegentlich noch Sterne am Gewölbe-Himmel, allerdings stark abstrahiert. So in der Chiesa Santa Maria di Castello in Genua oder in der St. Petri-Kirche auf Usedom. Und bei den Freimaurern finden wir den Sternenhimmel.
8.13 Manichäismus
Für uns Heutige, umfassend vertraut mit Kunstlicht, davon
abhängig und davon beherrscht, aufgeklärt über Physik und
Chemie der Sterne, ist kaum mehr nachvollziehbar, was Sonne,
Mond, Sterne und Planeten für die Menschheit vor dem
Siegeszug der Naturwissenschaften bedeuteten. Aus der Höhle
von Lascaux kennen wir eine Zeichnung der Plejaden, aber
ihre Funktion bleibt uns verborgen.Eine der eigenwilligsten vorwissenschaftlichen Bestimmungen von Sonne und Mond stammt von Mani, dem Begründer des Manichäismus, der 216 in der Nähe des heutigen Bagdad geboren wurde und 274 durch Folter oder Hinrichtung auf Geheiß des zoroastrischen Klerus starb. Nach der Kosmogonie Manis bestanden ursprünglich ein Licht- und ein Finsternisreich, die keine Berührung miteinander hatten, mit paradiesischen Zuständen im Lichtreich. Es kam zu einer Vermischung der beiden Reiche nach Übergriffen des Finsternisreiches auf das Lichtreich. Aus dieser Vermischung entstand die uns bekannte Welt, in der Lichtteile gefangen sind in dunkler Substanz. Durch religiöses Handeln können diese Lichtteile befreit werden und in das Lichtreich wandern - auf der Seelenreise des Menschen, über die beiden großen "Himmelslichter" als einer Art Schiffe. In der gnostischen Theologie hatten diese Funktion im Übergang zum Lichtreich die sieben Planetenmächte inne. Im manichäischen Kephalaion 64 wird von Adam und Eva gesagt, "(they) became a dwelling and home for the signs of the zodiac and the stars". Weitere kosmologische Spekulationen der Manichäer betrafen die Ernährung des Menschen, die nicht nur über Nahrungsmittel, sondern auch durch kosmische Einflüsse erfolge.
Bekannt ist auch die manichäische Proskynese (Niederwerfung) vor den beiden Himmelslichtern. Kocku von Stuckrad sieht in "Das Ringen um die Astrologie", veröffentlicht im Jahr 2000 bei De Gruyter, Kapitel X, darin jedoch keinen Hinweis auf eine polytheistische Vergottung von Sonne und Mond. Er geht vielmehr davon aus, dass Sonne und Mond von Mani als besonders erhabene Geschöpfe Gottes verehrt worden seien, in Anlehung an "die praktische() Religiosität Mesopotamiens, vielleicht auch Ägyptens" (Stuckrad 2000, S. 737). Im Kephalaion 65 wird gelehrt, dass es Satan gewesen sei, der den Menschen die Verehrung der Sonne verbot. Die Menschen hätten sich danach von der Sonne abgekehrt: "How many are the charities, that it does for mankind! Yet they, for their part, deny its graces, which they know not."
Reichhaltig sind die weitgehend aus dem kulturellen Fundus seiner Region übernommenen astrologischen Lehrstücke Manis. Dabei vollzieht sich eine ganz entscheidende Verschiebung: Als Elemente der Nacht, zugehörig dem Reich der Finsternis, werden die zwölf Tierkreiszeichen und die fünf Planeten nur mit negativen Wirkungen belegt, ausgeführt in Kephalaion 69. Allerdings werden die "himmlischen Kräfte" als begründend zuständig für gute wie schlechte Eigenschaften der Menschen angesehen - Kephalaion 48. Für Stuckrad waren bei Konflikten zwischen den Übernahmen aus der traditionelle Astrologie und der eigenen Lehre Manis die theologischen, nicht die astrologischen Kohärenzen entscheidend (s. Stuckrad 2000, S. 743). Die astrologischen Lehren der Manichäer wurden jedoch zu einem wesentlichen äußerlichen Grund der Verfolgung im römischen Reich. Die römische Gesetzgebung machte im 4. Jahrhundert "kaum noch Unterschiede (...) zwischen Astrologen, Magiern und Manichäern" (Struckrad 2000, S. 697).
9 Eine Typologie der Sternen-Leidenschaft
Sinnsucher und Mystiker - Die Ahnenreihe für diesen
Typus des Hobby-Astronomen ist lang und höchst
respektabel. Kant wurde oben bereits zitiert mit seinem
Diktum zum "bestirnten Himmel über mir". Obgleich seine
wenig gelesene "Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des
Himmels" von 1755 keinen Hinweis auf eigenen Gebrauch von
"Ferngläsern" gibt, sondern nur auf den Gebrauch durch
"Astronomen", darf er zu den Menschen gezählt werden, die
den Himmel mit der Bereitschaft betrachteten, dort etwas
von dem zu entdecken, was die Welt im Innersten
zusammenhält. Lange vor Kant hatten bis zurück zu den
Ägyptern und Babyloniern, ja noch weiter zurück bis in die
Höhlen von Lascaux und anderswo Menschen im Himmel
Antworten auf Menschheitsfragen gesucht. Und dass dieser
Typus auch nach Kants Aufklärung nicht ausgestorben ist,
zeigen Kinder, die ganz aus dem Häuschen geraten, wenn sie
zum ersten Mal Jupiter oder Saturn in einem Teleskop
"selber sehen".
Jäger und Sammler - Hier findet sich die
große Schar derer, die mit der Astrokamera oder ihrer
guten alten Spiegelreflex auf die Jagd nach Bildern von
ihrer Sonne, ihrem Mond, ihrem Lieblingsplaneten oder
ihren Nebeln und Galaxien gehen. Ihre Festplatten quellen
über von Bildern, die tausendfach ähnlich auch auf anderen
Festplatten sich stapeln - und doch sind es eben die
eigenen Bilder, und darin sind sie unvergleichlich. Oft
geben diese Bilder einen ersten Anstoß für diejenigen, die
diese Bilder sehen dürfen (ok, manchmal auch eher müssen,
aber sie könnten sich ja wehren!), selbst einmal (wieder)
bewusster nach oben zu schauen, trotz Lichtverschmutzung
und Smartphone und raus aus dem ganzen Bildermüll hier
herunten. Jäger und Sammler haben oft auch die besten
Augen, geschult im beständigen Abgleich, in beständiger
Nachführung.
Entdecker - Zu erkennen am filigransten Dobson auf
dem Platz. Und neben dem hocken sie auf einem riesigen
Thron und schauen, schauen was das Zeug hält immer in den
gleichen Himmelsausschnitt. Nur sie sind in der Lage, auch
in der größten Schwärze noch etwas zu entdecken - und sei
es ein schwarzes Loch! Es gibt auch noch einen ganz
entgegengesetzten Entdecker-Typus. Aber den habe ich nur
selten und nur sehr kurz gesichtet, da er mit einer
äußerst mobilen Ausrüstung immer auf der Flucht scheint.
In Wirklichkeit flieht er natürlich nicht, er sucht nur.
Den besten Platz, den besten Winkel, den besten Zeitpunkt.
Goldjungs - Unter ihnen kann man sich schon mal
fühlen wie bei einem Motorradtreff, wo es um den geilsten
Auspuff und das satteste Geröhre geht. Goldjungs haben
viel Geld in ihrer Ausrüstung gesteckt und das dürfen
andere auch gerne sehen. Das Auto, mit dem sie ihre
Ausrüstung kutschieren, könnte allerdings Probleme haben,
den nächsten TÜV zu bestehen. Der gelegentlich um sie
herum aufflammende Wettstreit um den längsten Tubus und
den dicksten Dobson hätte Freud sicherlich viel Freude
bereitet. Selbstredend gibt es nur Goldjungs, keine
Goldmädchen - von raren Ausnahmen abgesehen.
Die Geselligen - Ihnen gehören die Astrotreffs und
die gemeinsamen Beobachtungsnächte. Von ihnen kann mal
viel lernen, ohne erstmal eine schweigende Herbstnacht
kältebibbernd gemeinsam zu verbringen. Denn sie haben auch
einen satten pädagogischen Eros und in der Regel viel zu
erzählen! Auch wenn nicht alles aus ihrem eigenen
Erfahrungsschatz stammt, was dem Nutzen keinen Abbruch
tut. Eine Überprüfung der Fakten empfiehlt sich
gelegentlich.
Der Kiebitz - Seine eigene Ausrüstung (sofern er
eine hat) verstaubt im Keller. Er geht gerne mit, um die
Ausrüstung von Freunden fachmännisch zu bewerten. Wenn
sein Rücken es erlaubt (was selten der Fall ist), hilft er
auch beim Schleppen und Aufbauen. Bei Astrotreffen sammelt
er eifrig Beobachtungserfahrungen. Meist hat er auch ein
paar Dosen Bier dabei und Salzstangen. Öffentliche
Sternwarten meidet er.
Spechtler - Sie haben sich auf Ferngläser
spezialisiert und lieben die freihändige Beobachtung.
Weshalb sie Binokulare mit Winkeleinblick nur argwöhnisch
zur Kenntnis nehmen. Wichtigstes Utensil ist der Tisch für
ihre Sammlung an Gläsern. Und daneben ein Stuhl mit hoher
Rückenlehne, kippbar. Damit können sie ein Glas und den
Kopf stundenlang halten. Und gelegentlich auch mal den
Nacken entspannen, wenns denn dringend notwendig wird. Das
Berlebach-Stativ benutzen sie nur zu fortgeschrittener
Stunde. Mancher kam erst nach Jahren des Dobson-Schleppens
und -Schubsens zum Fernglas - und träumt nun von
20-60x125, zu einem Gewicht unter 2,5 Kilogramm. Galaxien?
Es gibt Wichtigeres!
Wissenschaftler - Bei ihnen hat alles schon in
früher Kindheit angefangen. Sie waren Preisträger bei
"Jugend forscht" und später haben sie Physik studiert und
heute sind sie Teil astronomischer Netzwerke, die Daten
etwa zu Meteoroiden sammeln. Ihre Jahreszeit ist der
tiefste Winter, gerne mit Schnee und Eis. In langen
Beobachtungsnächten trinken sie nur Kaffee ohne Milch und
Zucker und ihre Aufzeichnungshefte sind Legende! Ab 3 Uhr
morgens laufen sie gelegentlich blau an. Sie klagen über
Chinaschrott und vergessen, dass Galileo Galilei von so
manchem "Chinaschrott" hemmungslos begeistert gewesen
wäre!
Freaks - Sie haben den größten Teil ihrer
Ausrüstung selbst zusammengebastelt und können einige
Erfindungen vorweisen. An ihrem Tubus hängen vier
verschiedene Sucher mit einer vielfach verkabelten
Sucherkamera. Einen Sucher haben sie obligatorisch selbst
entwickelt. Dazu noch eine Sucherheizung mit Gebläse.
Gelegentlich zerschellt ein Teleskop beim Sturz von ihrer
selbstgebastelten Polhöhenwiege mit Nachführautomatik.
Manche von ihnen gründen einen Astroshop, der aber bald
pleite geht, wenn sie nicht einen tüchtigen
Geschäftsführer finden.
Ästheten - Sie sind die wahren Nebel-Jäger! Um
ihren Hals baumeln zahllose Filter, mit denen sie noch die
letzten blassen Farblichter aus den filigranen Windungen
der Medusa locken oder den Affenkopf in Blau- und Rottönen
entflammen lassen. Ihr Lieblingsaufenthalt ist der
Eskimo-Nebel, den sie nur mit Mackinlay's (sofern sie
nicht schon alles Geld für Filter ausgegeben haben) und
einem Komfortsessel ausgerüstet besuchen. Und mancher von
ihnen ging schon spurlos in SH2-199 verloren.
Melancholiker - Wie die Sinnsucher und Mystiker
brauchen sie eigentlich gar kein Teleskop. Meist findet
man sie neben der Ausrüstung im Gras liegend und in die
Weite schauend. Im Sommerhalbjahr wohlgemerkt. Oder sie
spazieren fern des Beobachtungsplatzes umher und machen
sich Notizen. Weniger zu ihren Beobachtungen, mehr über
das, was sie hätten beobachten können. Eigentlich
benötigen sie die Ausrüstung nur als Vorwand, um besonders
einsame Plätze mit dem Auto anfahren zu dürfen ohne
schlechtes Gewissen. Gelegentlich schauen sie auch durch
das Okular, aber ein Blick genügt, um sie erneut von der
grandiosen Nichtigkeit unserer Existenz zu überzeugen.
10 Glossar
ACF - Advanced Coma Free.
Alignment - Alignment, kurz auch "Align",
bezeichnet allgemein die Ausrichtung des Teleskops. Die
einfachste Form ist das Polar Alignment bei
EQ-Montierungen am Polarstern. Meist ist mit Alignment die
Einstellung der GoTo-Steuerungssoftware eines Teleskops
auf den an einem bestimmten Standort zu einer bestimmten
Zeit gegebenen Sternenhimmel gemeint. Ein gutes Alignment
ist die Voraussetzung dafür, automatisiert Objekte gezielt
anzusteuern und ihnen automatisch zu folgen bei der
"Wanderung" gegen die Erddrehung. Beim elektronisch
unterstützten Alignment ist zu unterscheiden zwischen dem
manuellen Ansteuern bei der Einstellung und der
automatischen Identifikation des Sternhimmels über
Bilderkennung. Beim manuellen Ansteuern muss eine bestimmt
Anzahl von Objekten nacheinander aufgesucht werden, um
deren Position in der Software abzuspeichern. Oft müssen
auch Zeit und Ortskoordinaten manuell eingegeben werden.
Im vollständigen Auto-Alignment erhält die Software über
GPS oder WLAN Informationen zu Standort und Zeit sowie
über eine Kamera eine Abbildung des vom Teleskop
anvisierten Himmelsausschnitts - und errechnet daraus über
Bildanalyse und Vergleich die Stellung des Teleskops zum
Sternenhimmel.
Amici-Prisma - "Amici" ist Italienisch und
bedeutet "Freunde". Freunden zeigt man die Welt so, wie
sie ist - nicht kopfstehend oder seitenverkehrt. Was das
Teleskop-Okular jedoch zeigt, ist in der Regel genau dies:
um 180 Grad gedreht oder seitenverkehrt. Ein Amici-Prisma
dreht das Bild wieder auf die Füße. Eine Umkehrlinse
leistet das Gleiche. Aber Achtung: Das "Amici-Prisma" hat
mit Freunden nichts zu tun, so schön das auch klingt. Der
Erfinder hieß Giovanni Battista Amici (1786-1863), ein
genialer Mathematiker, Optiker und Astronom aus Modena in
Norditalien.
AP - Die Austrittspupille (s. dort), im
Unterschied zur Eintrittspupille (EP).
AS - Aparent Size, angegeben in Bogenminuten/arcmin. Neben der VM/Visual Magnitude ist der Aparent Size von besonderer Bedeutung für die Wahrnehmbarkeit. Die Andromeda-Galaxie hat einen AS von 177.8 arcmin Länge, der Kugelsternhaufen M22 von 32.0 arcmin Durchmesser, die Whirlpool-Galaxie von 13.7x11.7 arcmin Fläche. Gut ausgestattete Planetariums-Programme wie Sky Safari oder Sky Guide bieten diese Daten.
Asterismus - Das griechische Wort ἀστερισμός
bedeutet schlicht "Sterngruppe". In der Astronomie wird
damit ein Sternbild bezeichnet, das nicht zu den offiziell
anerkannten 88 gehört. Am bekanntesten sind der Große und
der Kleine Wagen als Teile der Sternbilder Großer und
Kleiner Bär. Ein anderes Wort dafür ist "Konstellation".
Austrittspupille (AP) - Die Austrittspupille ist
der Durchmesser des Strahlenbündels, welches das Okular
zum Auge durchlässt. Ihr Maß ist in Millimetern angegeben
und ihr Wert entspricht dem Quotienten von Objektivöffnung
D ("Eintrittspupille" des Objektivs) in Millimetern und
jeweiliger Vergrößerung V, AP=D:V. Bei Kindern kann das
Auge (als "Eintrittspupille") bis zu 8mm bei weit
geöffneter Pupille aufnehmen, im fortgeschrittenen Alter
kann der Wert unter 4mm sinken, weil die Elastizität der
Pupillenmuskulatur abnimmt. Die mit der Vergrößerung
umgekehrt proportional sinkende AP ist der Grund für die
Abdunklung des Bildes mit zunehmender Vergrößerung. Die
optimale Vergrößerung im Blick auf die Lichtausbeute
errechnet sich mit der Formel V(opt)=D:6 - wobei 6 der
durchschnittliche Wert für die Eintrittspupille Auge ist.
Bei geringeren Vergrößerungen wird Licht "verschenkt", bei
höheren geht Licht an die Vergrößerung verloren. Dies ist
auch wichtig für die Beurteilung von Ferngläsern! Der
Austrittspupille AP korrespondiert die Eintrittspupille
EP.
Azimutal - "Azimut/Azimuth" kommt aus dem
Arabischen und bedeutet "Richtungen" oder "Wege". Gemeint
ist mit "azimutal" in der Astronomie die Ausrichtung zu
einem Objekt en face. Als würden wir den Körper drehen, um
einem Objekt genau gegenüber zu stehen. Dieser
horizontalen Bewegung folgt im Alltag die Bewegung in der
Höhe, das Heben oder Senken des Kopfes, um das Objekt ins
Zentrum des Gesichtsfeldes zu bekommen. Die azimutale
Ausrichtung, also Drehung um die Senkrechte, ist bei
azimutalen Montierungen die primäre, auf ihr basiert die
Ausrichtung in der Höhe (Altitude), die Drehung um die
Waagrechte. Diese Montierungen heißen auch
ALT/AZ-Montierungen. Sie entsprechen unserem Körpergefühl
und unserer Orientierung auf der Erdoberfläche und sind
daher für Nicht-Astronomen die vertrauteren. Wir kennen
sie im Prinzip auch aus der Fotografie mit Stativ: Erst
Schwenk, dann Höhenausrichtung. Gelegentlich wird bei
parallaktischen Montierungen die Drehung um die
Deklinationsachse auch als "azimutal" bezeichnet.
Bogenminute - Eine Bogenminute ist der 60. Teil eines Winkelgrades. Bogenminuten sind eine wichtige Größe zur Angabe der Genauigkeit einer GoTo-Steuerung. Beim Celestron NexStar SLT 127/1500 beträgt diese Genauigkeit 16 Bogenminuten. Damit wird es eher zur Glückssache, entfernte Galaxien (für die das Teleskop ohnedies nicht gemacht ist) aufzusuchen. Beim Meade ACF-SC 203/2000 aus der LX90-Serie liegt die GoTo-Genauigkeit bei 3 Bogenminuten - was seinen Preis hat. Eine Bogenminute ist gegliedert in 60 Bogensekunden. Das Auflösungsvermögen von Optiken wird in Bogensekunden angegeben.
Deep Sky Objects/DSO - Der "tiefe Himmel" ("deep
sky") ist die Bezeichnung für den Kosmos außerhalb unseres
Planetensystems. Verwendet wird der Ausdruck "Deep Sky
Objects" (DSO) vor allem für die amateurastronomisch
interessanten Objekte in diesem Bereich, Sternhaufen,
Nebel und Galaxien. Da unsere Milchstraße einen
Durchmesser von etwa 200.000 Lichtjahren (früher wurden
100.000 angegeben) und eine maximale Dicke von etwa 1.000
Lichtjahren misst, enthält sie bereits eine immense Anzahl
dieser Objekte. Die Zahl der Sterne in unserer Galaxie
wird auf mindestens 100 Milliarden Sterne geschätzt. Meist
wird von 200-400 Milliarden gesprochen. Die Milchstraße
enthält in ihrem Randbereich/Halo etwa 500
Kugelsternhaufen, davon sind etwa 150 bekannt. Selbst zwei
gleichsam angehängte Zwerggalaxien bietet die Milchstraße,
die beiden Magellanschen Wolken.
Deklination - Der himmlische Breitengrad. Deklination (Dek/Dec) und Rektaszension (RA) entsprechen auf der Himmelskarte den geographischen Breiten- und Längengraden.
EAA - "Electronically Assisted Astronomy".
Astronomie mit der Unterstützung durch Elektronik bei
Alignment, Auffinden, Nachführung und Bildqualität.
Eintrittspupille (EP) - Bezeichnet beim Teleskop
die Objektivöffnung in Millimetern. Relevant in der
Astronomie ist auch die EP des menschlichen Auges (maximal
7mm, abhängig vom Alter und vom einfallenden Licht, das
die Pupille sich schließen lässt). Ist die
Austrittspupille des Okulars größer als die individuelle
EP, wird Licht verschenkt. Ist sie kleiner, sollte bei
lichtschwachen Objekten eine geringere Vergrößerung
gewählt werden. Denn die Formel lautet: Austrittspupille =
Öffnung : Vergrößerung. In der Jugend misst die EP 7-8mm,
im Alter kann sie unter 4mm sinken. Es gibt allerdings
gravierende individuelle Unterschiede und man sollte sich
nicht auf die gängigen Tabellen mit den Werten für die
Altersgruppen verlassen. Als Faustregel kann gelten, dass
die eigene EP noch weit ist, wenn man keine Probleme mit
dem Dämmerungssehen hat. Und natürlich erreiche ich meine
optimale EP nur, wenn meine Pupille sich nicht durch
seitlich einfallendes Licht bedingt zusammenzieht. Im
Zweifelsfalle vor einem Fernglas-Kauf mit Gläsern von
Freunden ohne seitlich aufs Auge fallendes Licht
ausprobieren, ob man mit einem 10x70-Glas (AP7) am
Nachthimmel wesentlich mehr erkennen kann als mit einem
10x50-Glas (AP5).
Ekliptik - So heißt die von der Erde aus
beobachtete scheinbare Sonnenbahn durch den Sternhimmel,
bedingt durch die Drehung der Erde um die Sonne. Auch die
anderen Planeten unseres Sonnensystems bewegen sich -
scheinbar - auf dieser Bahn, da sie alle auf der gleichen
Ebene mit der Erde um die Sonne kreisen. Und damit ziehen
die Planeten auch auf der Ekliptik durch die Sternbilder,
was die Astrologen beschäftigt. Als "Goldenes Tor der
Ekliptik" wird die Passage zwischen den Hyaden und den
Plejaden bezeichnet. Auch der Mond bewegt sich in etwa auf
der Ekliptik, verfehlt das "Goldene Tor" allerdings
gelegentlich. Bei den Sumerern wurde Neujahr als "Akiti"
gefeiert, wenn die Sonne durch das Goldene Tor zog. Was
2000 v. Chr. nach heutigem Kalender Mitte April geschah,
zur Zeit der Gersteaussaat.
EP - Die Eintrittspupille (s. dort), im
Unterschied zur Austrittspupille AP (s. dort).
EQ-Plattform - "EQ" steht für englisch "equatorial", die Abkürzung wird auch verwendet für äquatoriale/parallaktische Montierungen. Eine EQ-Plattform ist das Äquivalent der EQ-Montierung für Dobsons. Sie besteht aus zwei Platten, einer fixen unten, die nach Norden ausgerichtet wird, und einer beweglichen oben, dem "Tisch". Die Konstruktion ermöglicht die Nachführung über eine "virtuelle" Achse, die auf den Polarstern gerichtet ist, um die der "Tisch" leicht gedreht wird. Die obere Platte wird also keineswegs zum Polarstern ausgerichtet geneigt (sonst würde der Dobson runterfallen), sie neigt sich erst im Verlauf der Nachführung ganz leicht, indem sie auf einer Seite absinkt, auf der anderen ansteigt, wobei sie sich annäherungsweise um die virtuelle Rektaszensionsachse dreht.
Fixstern - Dieser Ausdruck für Sterne im
Unterschied zu Planeten ist bereits bei Johannes Kepler
1609 ("Antwort auf Röslini Discurs") nachzuweisen als
Gegenbegriff zum Fremdwort "Planet" (der griechische
Ausdruck für Planet ist "planetes aster", umherirrender
Stern).
Galaxis - Das griechisch Wort γάλακτος ist der
Genitiv von "γάλα", "Milch". Beim Anblick des
Milchstraßen-Bandes glaubten die Griechen der Frühzeit,
hier hätten die Götter Milch verschüttet. Ursprünglich
bezeichnete der Ausdruck "Galaxis" nur unsere Galaxie. Mit
der Identifikation weiterer Galaxien Anfang des 20.
Jahrhunderts und dem Beweis ihrer Existenz durch Edwin
Hubble am 5. Oktober 1923 wurde der Begriff dann auch auf
diese übertragen. Das Adjektiv "galaktisch" bezeichnet
aber weiterhin nur Phänomene unserer Galaxie, der
"Milchstraße".
Goldenes Tor - Die imaginäre Pforte zwischen
Hyaden und Plejaden. Genauer: "Goldenes Tor der Ekliptik",
da die Sonne und mit ihr die Planeten dieses "Tor" auf
ihren Bahnen passieren.
Justierung - Mit drei verschiedenen Justierungen haben wir es in der Amateurastronomie zu tun. Zum ersten und sehr oft ist die Justierung des Suchers auf das Teleskop zu machen. Damit erreichen wir, dass wir im Teleskopokular das gleiche Objekt im Zentrum haben, das wir auch im Sucher im Zentrum sehen. Bei GoTo-Montierungen müssen wir die Steuerungssoftware auf den Standort unseres Teleskops, die Uhrzeit und die Position des Teleskops zum Sternenhimmel einstellen. Diese Justierung heißt "Alignment". Danach kann die Software gezielt Objekte ansteuern. Die dritte Justierung ist seltener zu machen und auch nur bei Spiegelteleskopen. Mit ihr stellen wir den Hauptspiegel und ggf. auch den Fangspiegel auf einen korrekten Strahlengang ein. Sie heißt "Kollimation".
Kollimation - In der Optik bedeutet Kollimation die Ausrichtung der Lichtstrahlen in gerader Linie. Beim Spiegelteleskop ist damit gemeint, den Hauptspiegel so auszurichten, dass das reflektierte Bild genau auf den Fangspiegel projiziert wird. Dies sollte bei Newton-Teleskopen regelmäßig gemacht werden, vor allem nach Erschütterungen durch einen Transport. Bei manchen Modellen kann auch der Fangspiegel kollimiert werden. Bei Ferngläsern geht es um die Ausrichtung der beiden getrennten "Tuben" aufeinander.
Lichtsammelleistung - Die Lichtsammelleistung eines Objektivs ist der Faktor, um welchen die Lichtaufnahme des Objektivs höher ist als die Lichtaufnahme einer menschlichen Pupille. Die Formel lautet Lichtsammelleistung = Öffnung2 : EP 2 - wobei EP die Eintrittspupille des menschlichen Auges meint, die häufig unkorrekt auch als AP bezeichnet wird. Sie beträgt in jungen Jahren 7mm und sinkt im Alter auf 4mm. Da es primär darum geht, Optiken vergleichbar zu machen, wird von Händlern in der Regel der Wert AP=7 angenommen. Ein Objektiv von 100mm hat daher eine Lichtsammelleistung von 204x, eines von 200mm eine von 816x. Was von dieser Leistung wirklich im Auge ankommt, hängt einmal von der Optik ab, die bei allen Teleskoptypen etwa 10% des Lichts schluckt, einmal von der gewählten Vergrößerung, die eventuell die Austrittspupille des Okulars unter das Maß der EP des Auges verkleinert. Und schließlich auch von der EP des individuellen Auges, das eventuell gar nicht alles aufnehmen kann, was das Okular liefert. Einmal altersbedingt, aber auch bei seitlich auf das Auge fallendem Licht, wodurch die EP des Auges kleiner wird, da die Pupille sich nicht vollständig weitet.
Mittsommernachtseffekt - Rund um die Sommersonnenwende sinkt auch in südlicheren Breiten Deutschlands die Sonne nur noch wenig unter den Horizont. Das bewirkt vor allem im Nordwesten des Nachthorizontes eine Aufhellung, die sich auf den gesamten Nachthimmel störend auswirkt. Juni und Juli sind Monate, in denen vor Mitternacht nur wenig geht.
Nebel - Für Charles Messier mit seinen 3-Zöllern
war fast alles noch undifferenziert "Nebel", was wir heute
als Sternhaufen, Emissionsnebel, planetarische Nebel,
Galaxien differenzierter kennen. Manches davon heißt noch
immer gelegentlich "Nebel", obgleich längst als Galaxie
bekannt und erforscht, etwa der "Andromeda-Nebel" oder die
beiden "Bode-Nebel". "Echte" Nebel, hinter denen sich
nicht nur eine Anzahl durch Nähe zueinander und/oder
Entfernung zu uns dicht gedrängter Sterne verbergen,
werden unterschieden in drei Gruppen, Dunkle Nebel,
Reflexionsnebel und Emissionsnebel. Dunkle Nebel bestehen
aus Staubpartikeln, die kein Licht reflektieren.
Reflexionsnebel reflektieren das Licht naher Sterne.
Emissionsnebel, die umfangreichste Gruppe, bestehen aus
Gasen, die selbst leuchten, angeregt durch das Licht
umgebender Sterne oder die Energie eines Pulsars bei
Überresten einer Supernova (Cirrusnebel, Krebsnebel) oder
eines Weißen Zwerges bei Überresten eines weniger
massereichen Sterns (Blinkender Nebel, Hantelnebel).
Objektiv - Das Objektiv ist beim
Linsenteleskop/Refraktor die Gesamtheit der kombinierten
Linsen (bei einem Apochromaten können das 3 oder 4 Linsen
sein). Beim Reflektor wird der Hauptspiegel als Objektiv
bezeichnet. Es gibt auch Mischformen, die
Spiegellinsenobjektive, vor allem in der Fotografie. Bei
Teleskopen kann man die Maksutovs so nennen - allerdings
werden sie in der Regel den Reflektoren zugeschlagen.
Obstruktion - Obstruktion nennt man beim Teleskop
die Abschattung, den Kontrastverlust durch den Lichtweg.
Beim Linsenteleskop geht die Obstruktion gegen Null, bei
Spiegelteleskopen ist die Obstruktion abhängig vom
Fangspiegel. Der Fangspiegel lenkt das vom Hauptspiegel
kommende Licht um, in das Okular. Die Obstruktion beträgt
nach einer Faustregel den Wert des
Fangspiegeldurchmessers. Die Kontraststärke eines
Reflektors mit 200mm Hauptspiegeldurchmesser und 60mm
Fangspiegeldurchmesser entspricht daher etwa der eines
Linsenteleskops mit 140mm Objektivdurchmesser, die
Obstruktion beträgt 30%. Die Lichtleistung geht durch den
Fangspiegel auch etwas zurück, aber nicht im gleichen
Maße, im vorliegenden Beispiel um etwa 9%.
Öffnungsverhältnis - Das Öffnungsverhältnis ist
das Verhältnis zwischen Öffnung (Objektiv- bzw.
Hauptspiegel-Durchmesser) und Brennweite. Angegeben wird
es z.B. beim Skywatcher 200/1000 wie folgt: 1:5 oder 1/5.
Für die Fotografie (den Belichtungsbedarf) gilt: je
geringer die Brennweite in Relation zur Öffnung ist, umso
"schneller" ist das Öffnungsverhältnis, je höher, umso
"langsamer". 1:5 gilt als "schnelles" Öffnungsverhältnis,
1:10 wäre ein "langsames" Öffnungsverhältnis (= lange
Belichtungszeit notwendig).
Öffnungszahl - Die Öffnungszahl ist der Kehrwert
des Öffnungsverhältnisses, im obigen Beispiel also 5,
angegeben als f/5. Dies entspricht der Blendenzahl in der
Fotografie. Niedrige Öffnungszahlen eignen sich
astrofotografisch für lichtschwache und ausgedehnte
Objekte (Galaxien, Nebel), da sie kürzere
Belichtungszeiten benötigen (= schnelles
Öffnungsverhältnis). Hohe Öffnungszahlen (= langsames
Öffnungsverhältnis) sind geeignet bei hellen Objekte mit
hohem Vergrößerungsbedarf zur Detailbetrachtungen, also
etwa Mond, Sonne, Planeten wie Jupiter und Saturn, da sie
das Fokussieren erleichtern (Tiefenschärfe-Phänomen) und
der (an sich höhere) Belichtungszeitbedarf durch die
Objekthelligkeit reduziert ist.
Okular - Das Okular (von "oculus", lat. für
"Auge") erlaubt es, das vom Teleskop erzeugte Bild
wahrzunehmen und zu vergrößern. Es sitzt entweder am
tiefen Ende des Teleskops bei Refraktoren, am hohen Ende
des Teleskops bei Newtons oder wiederum am tiefen Ende bei
Schmidt-Cassegrains und Maksutovs (alle drei sind - grosso
modo - Reflektoren). Durch die Wahl des Okulars wird die
Vergrößerung bestimmt, sie hat den Wert "Brennweite
Teleskop : Brennweite Okular". Zoomokulare haben variable
Brennweiten.
Okularauszug - Der Okularauszug (OAZ)
verbindet das Teleskop mit dem Okular und ist in der Länge
verstellbar, um die Scharfstellung des Bildes zu
ermöglichen. Bei Schmidt-Cassegrains und Maksutovs wird
zur Scharfstellung der Hauptspiegel bewegt (es heißt dann
gelegentlich, der Okularauszug liege "innen", was den
Sachverhalt nicht ganz trifft), das kann zu kleinen
Verzerrungen beim Fokussieren durch "Mirror-Shifting"
(Spiegelverschiebung) führen. Es gibt von Svbony den
Doppel-Helix-Fokussierer 1,25'' oder von Omegon den
Crayford-Auszug 2'', die beide die Feinschärfung
übernehmen können, um Mirror-Shifting zu vermeiden. Das
ist aber primär ein Thema für die Astrofotografie.
OTA - "Optical Tube Assembly" - Tubus alleine, u.U. mit Okularauszug, Okular, Sucher.
Parallaktisch - Parallaxe geht zurück auf das
altgriechische παράλλαξις - was Verschiebung bedeutet. In
der Astronomie wird das Wort verwendet zur Bezeichnung
eines bestimmten Montierungstypus. Bei einer
parallaktischen Montierung (auch EQ-Montierung -
EQ=equatorial) wird die scheinbare Bewegung der Sterne
durch die Erddrehung dadurch kompensiert, dass das
Teleskop in der Gegenrichtung verschoben wird, durch
Drehung um die Rektaszensionachse, die parallel zur Achse
der Erddrehung liegt. Die Rektaszensionsachse ist bei
parallaktischen Montierungen die basale, auf ihr steht die
sogenannte Deklinationsachse im rechten Winkel. Diese
Montierungen heißen auch RE/DEC-Montierungen.
Parsec (pc) - Astronomische Längeneinheit,
entspricht 3,26 Lichtjahren. Abgekürzt "pc".
Planetarischer Nebel - Mit Planeten hat dieser
Nebeltypus nichts zu tun, der Name geht auf die häufige
Kugelform zurück, die beim Blick durch historisch ältere,
schwächere Teleskope an Gasplaneten denken lässt. Ein
Planetarischer Nebel entsteht, wenn ein Stern von der
Masse unserer Sonne bis maximal der achtfachen Masse
"stirbt". Dann werden die äußeren Teile als Gase
abgestoßen und das Zentrum verwandelt sich in einen Weißen
Zwerg, dessen Strahlung den Nebel zum Leuchten bringt.
Auch unsere Sonne wird einmal als Planetarischer Nebel
enden. Größere Sterne enden in einer Supernova.
Rektaszensionsachse - Bei parallaktischen
Montierung ist dies die Achse parallel zur Erdachse, um
die sich der Tubus dreht bei der Nachführung eines Sterns
oder Planeten, um dessen Verschiebung durch die Erddrehung
auszugleichen. Sie wird auch Stundenachse genannt.
Senkrecht zu ihr steht die Deklinationsachse, um die der
Tubus vor Beginn der Nachführung auf das jeweilige Objekt
ausgerichtet wird. Rektaszension (RA) und Deklination
(Dek/Dec) entsprechen auf der Himmelskarte, der
Himmelssphäre den geographischen Längen- und
Breitengraden.
Schiefspiegler - Ein Sonderfall der Reflektoren ist der Schiefspiegler. Hier befindet sich der Fangspiegel nicht im primären Lichtweg, vor dem Hauptspiegel, sondern seitlich am Tubus. Der Hauptspiegel ist leicht geneigt und wirft das Licht durch eine Öffnung im Tubus nach außen, wo der gleichfalls leicht geneigte Sekundärspiegel/Fangspiegel das Licht in einem kleineren Tubus zum Okular führt. Damit hat der Schiefspiegler - wie ein Refraktor - keine Obstruktion.
Seeing - Der englische Ausdruck für "Sehen" als
Vorgang bezeichnet in der Astronomie die äußeren
Sehbedingungen, die Klarheit des Himmels, den Grad der
Verzerrung durch Warm- und Kaltluftströme oder sonstige
Luftturbulenzen, die Einflüsse von Mondlicht,
Sonnenrestlicht, Lichtverschmutzung. Ohne gutes "Seeing"
bleiben die Beobachtungsergebnisse oft dürftig.
Korrigierbar ist schlechtes Seeing teilweise durch Filter
oder digitale Bildverarbeitung. Ansonsten helfen nur
Standortwechsel oder eine andere Beobachtungszeit.
Stacking - Englisch "to stack" bedeutet
"schichten", "stapeln". Mit Stacking wird in der
Astrofotografie das digitale Übereinanderlegen
verschiedener Aufnahmen des gleichen Objektes und die
Verarbeitung der zusammengefassten Bildinformationen durch
eine geeignete Software verstanden.
Starhopping - Die grundlegende Strategie zum
Auffinden von Himmelsobjekten ohne GoTo ist das
"Sternehüpfen". Man beginnt (am besten zunächst mit dem
Fernglas) bei einem leicht aufzufindenden hellen Stern und
"hüpft" von diesem aus weiter in Richtung des gesuchten
Objektes über markante Zwischenschritte (andere etwas
weniger helle Sterne, Sternpaare, Sternlinien,
Sternwinkel, Sternbögen, Vierecke ...).
Subjektiver Sehwinkel - Der subjektive Sehwinkel
ist eine wichtige Größe zur Bestimmung der
Beobachtungsqualität bei Ferngläsern. Er ist eine Funktion
von Sehfeld und Vergrößerung. Wenn ich ein bestimmtes
Sehfeld durch eine höhere Vergrößerung näher zu mir
bringe, habe ich den subjektiven Eindruck eines größeren
Sehfeldes. Ein objektives Sehfeld von 60 Metern auf 1000
Meter wirkt mit einer 10fachen Vergrößerung enger
("Tunnelblick") als ein Sehfeld von 55 Metern mit 20facher
Vergrößerung ("Weitwinkel"-Effekt). Das Sehfeld schrumpft
mit zunehmender Vergrößerung (was gleichfalls zum
"Tunnelblick" führt), der subjektive Sehwinkel steigt mit
der Vergrößerung. Ab 60° subjektivem Sehwinkel darf von
einem Weitwinkel-Fernglas gesprochen werden. Das
entspricht etwa dem Wert 1050 aus dem Produkt von Sehfeld
und Vergrößerung.
Supernova - Eine Supernova ist das Ende eines
Sterns von mindestens achtfacher (nach anderen Angaben
mindestens zehnfacher) Sonnenmasse in einer gewaltigen
Explosion, die den Stern vollkommen zerstört - während bei
geringerer Masse ein Planetarischer Nebel mit einem Weißen
Zwerg im Zentrum entsteht. Im Zentrum einer Supernova
bildet sich ein Schwarzes Loch oder ein Neutronenstern. Es
gibt seit 2021 konkrete Hinweise, dass auch eine Kollision
von Sternen eine Supernova auslösen kann. Desgleichen
Hinweise darauf, dass zwischen achtfacher und zehnfacher
Sonnenmasse eine sogenannte Elektronen-Einfang-Supernova
stattfinden kann. Die letzte von Menschen beobachtete und
in extenso untersuchte Supernova ereignete sich am 23.
Februar 1987 in der Großen Magellanschen Wolke. Die erste
dokumentierte Supernova wurde am 4. Juli 1054 von
chinesischen Astronomen registriert - ihre
Hinterlassenschaft ist der Krebsnebel.
VM - Visual Magnitude, Scheinbare Helligkeit,
angegeben in +/-mag, bezogen auf den Lichtbereich um 550
nm - das ist der Bereich Gelbgrün. Sie ist für die
Beobachtung zu ergänzen durch den Wert AS/Aparent Size.
Die Scheinbare Helligkeit ist ein Wert auf einer
logarithmischen Skala, wobei der niedrigste Wert die
größte Helligkeit hat. Diese Einteilung geht zurück auf
die Helligkeitsskala des Ptolemäus von Alexandria, die
ihrerseits auf babylonischen Einteilungen beruht.
Ptolemäus teilte im "Almagest" um 140 nach Christus die
damals sichtbaren Sterne in 6 Klassen ein. Klasse 1 waren
die hellsten, Klasse 6 die dunkelsten Sterne. Später wurde
die Skala in beiden Richtungen erweitert. Wega galt lange
Zeit als Referenzstern/Nullpunkt mit +0.02, Sirius als
hellster Stern (den Ptolemäus nicht sehen konnte) hat den
Wert -1.44, der Vollmond -12.5, die Sonne -26.7. Venus als
hellster Planet zeigt sich mit -4.2, gefolgt von Jupiter
mit -2.4. Saturn kommt im Vergleich nur auf +0.6, Mars auf
+1.8. Uranus mit +5.8 und Neptun mit +7.8 bleiben uns ohne
Hilfsmittel verborgen. Die Andromeda-Galaxie M31 schimmert
mit +3.28, der Kugelsternhaufen M22 mit +5.09, die
Dreiecksgalaxie M33 mit +5.79, die Bode-Galaxie M81 mit
+6.77, der Hantelnebel M27 mit +7.09, die Whirpool Galaxy
M51 mit +7.92. Apps wie Sky Safari (meine Quelle) oder Sky
Guide bieten diese Daten. Das "normale" gesunde Auge sieht
bei dunklem Himmel bis etwa +6, ein 70mm-Fernglas bis +10,
ein 8''/200mm-Teleskop bis +14. Hubble Space erfasst bis
+30.
Wandelstern - In der astronomischen Terminologie des ausgehenden 17. Jahrhunderts wurden die Planeten erstmals auch als "Wandelsterne" bezeichnet, in Übersetzung des griechischen Ausdrucks "planetes aster", "umherirrender Stern", "Wanderstern", da Planeten ihren Ort am Himmel in Relation zu den Sternen verändern, die schon etwas länger "Fixsterne" genannt wurden. Im 19. Jahrhundert tauchte auch die Bezeichnung "Wanderstern" auf. Die Bezeichnung "Wandelstern" oder die neuere Form "Wandelgestirn" werden auch heute noch verwendet. Meist sind dann Sonne und Mond mitumfasst, bisweilen auch Zwergplaneten, Asteroiden und Kometen.
Webb Space Telescope - Noch mehr als das Hubble
Space Telescope wird das Nachfolgemodell unser Bild des
Universums verändern. Wir schauen in Richtung des Urknalls
genauer als je zuvor, im Infrarotbereich bis ran an das
"Dark Age" vor 13,4 Milliarden Jahren. Am 11. und 12. Juli
2022 wurden die ersten Bilder freigegeben. Der Durchmesser
der Wabenstruktur des Webb beträgt 6,5 Meter, der runde
Hauptspiegel von Hubble maß diametral 2,4 Meter. Die
Gesamtkosten des auf 10 Jahre veranschlagten Projekts
betragen 8,8 Milliarden US-Dollar. Seinen Namen hat das
Teleskop von einem NASA-Offiziellen, James Webb
(1906-1992), Verantwortlicher der Apollo-11-Mission
1961-1968. Kein Wissenschaftler, sondern ein
Verwaltungschef, der jedoch entscheidend dafür gesorgt
hat, dass die NASA als ziviles Projekt dem Militär
gegenüber unabhängig blieb und Geld bekam.
Zirkumpolare Sternbilder - Sie umkreisen für
unsere Wahrnehmung den Himmelspol beim
Nordstern/Polarstern und bleiben dabei ganzjährig und im
gesamten Verlauf der Nacht sichtbar, auch wenn sie
bisweilen nahe an den Horizont geraten und dann nur
schlecht zu beobachten sind. Zu ihnen gehört zunächst der
Kleine Bär/Kleine Wagen mit dem Polarstern/Polaris als
vorderstem Deichselstern. Um ihn gruppieren sich
Kassiopeia, Kepheus, Drache und Giraffe. In etwas größerem
Abstand steht der Große Bär/Große Wagen. Die Tochter von
Kepheus und Kassiopeia, Andromeda, und ihr Mann Perseus
ragen nur teilweise in den zirkumpolaren Bereich, nahe bei
Kassiopeia, der Mutter.
- Nach oben
-